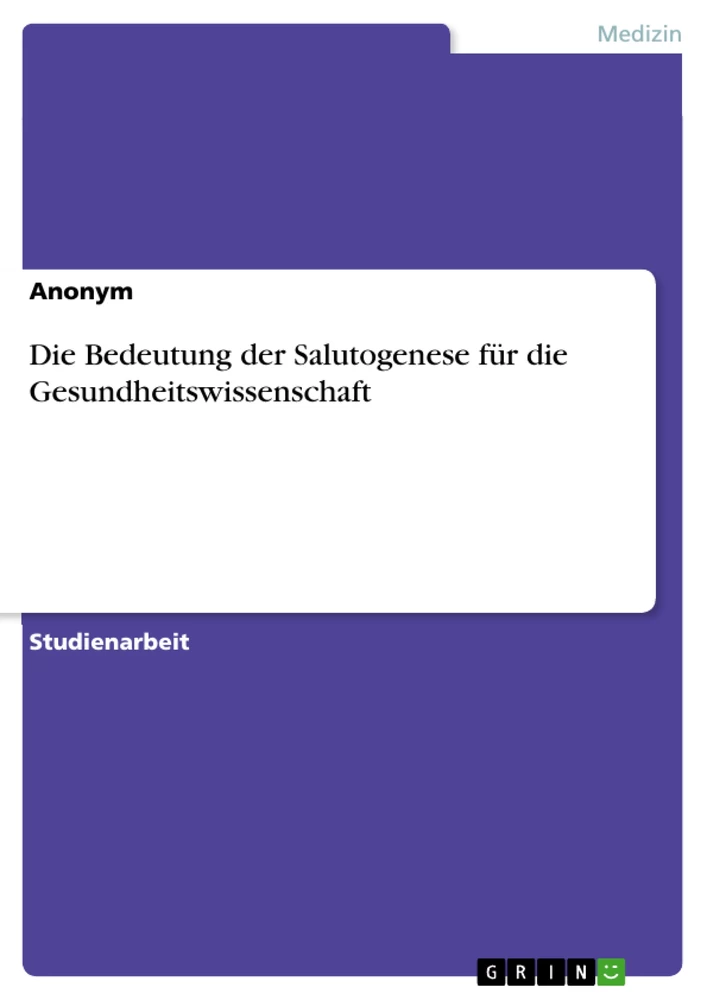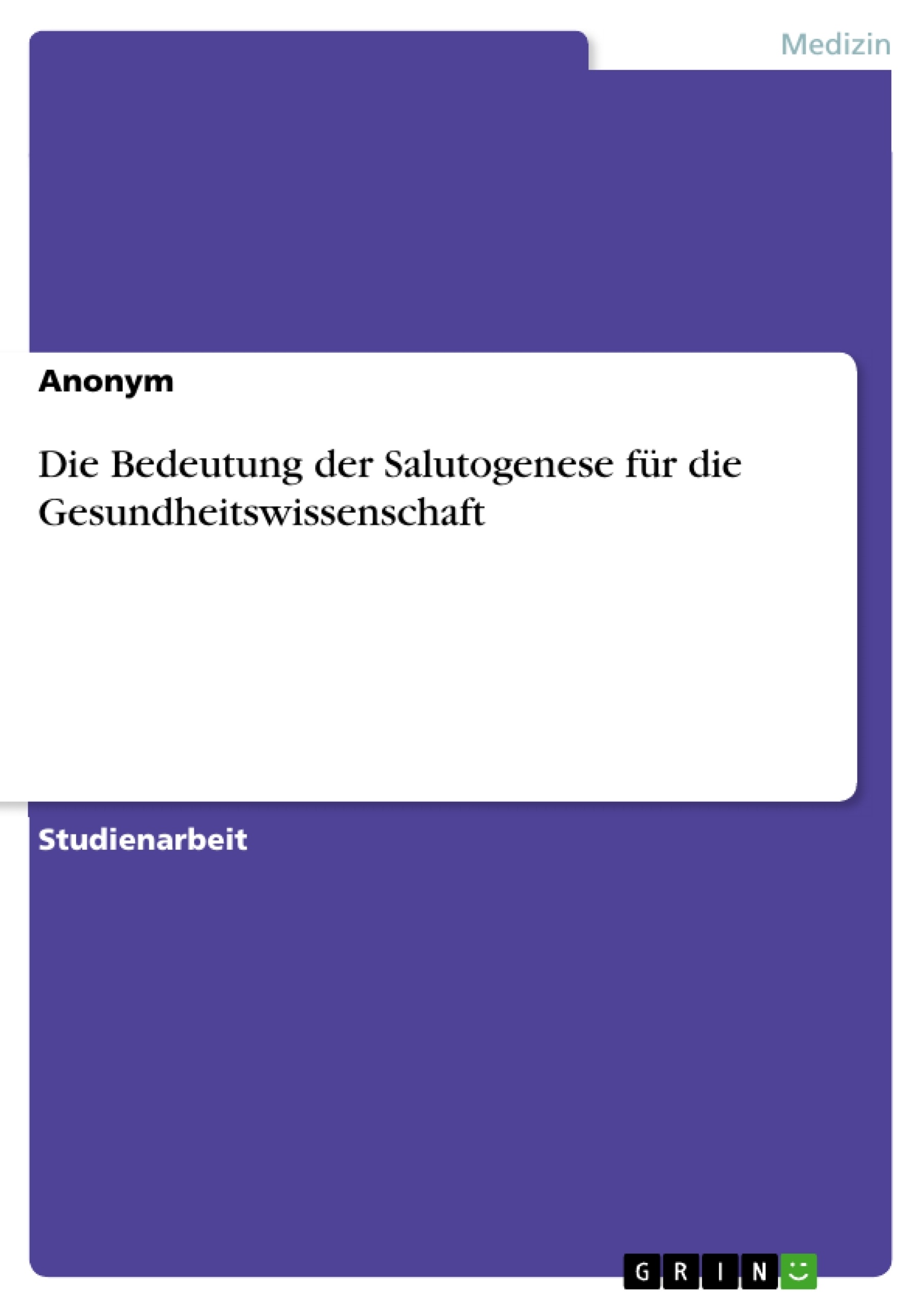In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wertete der israelisch – amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) eine Erhebung über die Adaption von Frauen an die Menopause aus und stellte dabei fest dass sich 29% einer Gruppe in einem guten mentalen Zustand sahen.
Die Besonderheit: Alle Teilnehmer dieser Gruppe waren ehemalige Inhaftierte eines Konzentrationslagers die zwischenzeitlich nach Israel emigriert waren.
Anders als in der pathogenesen Perspektive fragte Antonovsky nicht warum 71% der Teilnehmer dieser Gruppe „krank“ waren, sondern warum immerhin 29% der Untersuchungsgruppe sich in einem guten emotionalen Zustand befand - was erstaunlich erschien angesichts dieser traumatischen Vergangenheitserlebnisse.
Die Ausgangsfrage der Salutogenese (lat. „salus“: Unverletztheit, Heil, Glück; griech. „genese“: Entstehung) war hiermit geboren.
Während die Medizin ihren Fokus darauf legt wie Krankheit vermieden und kuriert werden kann und sich die Frage stellt „Was macht krank?“, verfolgte Antonovsky eine andere Herangehensweise.
Seine Frage war: Was macht die Leute gesund und welche Aspekte/ Determinanten bewegen den Menschen in Richtung Gesundheit?
Mit diesem Ansatz vollzog Antonovsky einen Paradigmenwechsel.
Im Folgenden werde ich versuchen sein Modell der Salutogenese kurz zu skizzieren und anschließend die Rezeption des Modells in der Literatur beleuchten.
Abschliessen möchte ich mit einem persönlichen Fazit indem ich versuche die Frage zu erörtern, inwiefern Pflegekräfte den salutogenetischen Ansatz in der alltäglichen Berufspraxis umsetzen können.
Aufgrund der formalen Vorgaben die Hausarbeit in mindestens 12 und maximal 15 Seiten zu erstellen, wird all dies in stark komprimierter Form geschehen.
Inhaltsverzeichnis
1 Paradigmenwechsel – Von der Pathogenese zur Salutogenese
2 Das Konzept der Salutogenese nach Antonovsky
2.1 Gesundheits – Krankheits – Kontinuum
2.2 Gesundheitszustand als Ergebnis aus belastenden und schützenden Faktoren
2.2.1 Belastende Faktoren (Stressoren)
2.2.2 Schützende Faktoren (Widerstandsressourcen)
2.3 Konzept des „Kohärenzsinns/-gefühls“
2.3.1 Verstehbarkeit
2.3.2 Handhabbarkeit
2.3.3 Sinnhaftigkeit
3 Rezeption
3.1 Positive Aspekte – Stärken des Modells
3.2 Negative Aspekte – Schwächen des Modells
4 Fazit
Glossar
Literaturverzeichnis
1 Paradigmenwechsel – Von der Pathogenese zur Salutogenese
In den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts wertete der israelisch – amerikanische Medizinsoziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) eine Erhebung über die Adaption von Frauen an die Menopause aus und stellte dabei fest dass sich 29% einer Gruppe in einem guten mentalen Zustand sahen.
Die Besonderheit: Alle Teilnehmer dieser Gruppe waren ehemalige Inhaftierte eines Konzentrationslagers die zwischenzeitlich nach Israel emigriert waren.
Anders als in der pathogenesen Perspektive fragte Antonovsky nicht warum 71% der Teilnehmer dieser Gruppe „krank“ waren, sondern warum immerhin 29% der Untersuchungsgruppe sich in einem guten emotionalen Zustand befand - was erstaunlich erschien angesichts dieser traumatischen Vergangenheitserlebnisse.
Die Ausgangsfrage der Salutogenese (lat. „salus“: Unverletztheit, Heil, Glück; griech. „genese“: Entstehung) war hiermit geboren.
Während die Medizin ihren Fokus darauf legt wie Krankheit vermieden und kuriert werden kann und sich die Frage stellt „Was macht krank?“, verfolgte Antonovsky eine andere Herangehensweise.
Seine Frage war: Was macht die Leute gesund und welche Aspekte/ Determinanten bewegen den Menschen in Richtung Gesundheit?
Mit diesem Ansatz vollzog Antonovsky einen Paradigmenwechsel.
Im Folgenden werde ich versuchen sein Modell der Salutogenese kurz zu skizzieren und anschließend die Rezeption des Modells in der Literatur beleuchten.
Abschliessen möchte ich mit einem persönlichen Fazit indem ich versuche die Frage zu erörtern, inwiefern Pflegekräfte den salutogenetischen Ansatz in der alltäglichen Berufspraxis umsetzen können.
Aufgrund der formalen Vorgaben die Hausarbeit in mindestens 12 und maximal 15 Seiten zu erstellen, wird all dies in stark komprimierter Form geschehen.
2 Das Modell der Salutogenese nach Antonovsky
Für Antonovsky ist Gesundheit kein fester, „normaler“ und passiver Zustand sondern ein labiler Zustand der aktiv erhalten werden muss; ein sich dynamisch regulierendes System.
Salutogenetische Orientierung rührt nach Antonovsky „aus dem fundamentalen Postulat, daß [sic!] Heterostase, Altern und fortschreitende Entropie die Kerncharakteristika aller lebenden Organismen sind“ (Antonovsky 1997: 29).
2.1 Gesundheits – Krankheits – Kontinuum
Antonovsky hebt die „klassische“ Dichtomie krank oder gesund auf und entwirft stattdessen ein Gesundheits – Krankheits – Kontinuum.
In diesem Kontinuum platziert er die beiden (gegensätzlichen) Pole Gesundheit und Krankheit.
Die Frage ist nunmehr, wo eine Person auf diesem Kontinuum anzusiedeln ist bzw. wie nahe/ entfernt die Person von den beiden Extremen/ Polen ist.
Die beiden Pole sind dabei für lebende Organismen nicht zu erreichen. Denn „ebenso sind wir alle, solange noch ein Hauch von Leben in uns ist, in einem gewissen Ausmaß gesund“ (Antonovsky 1997: 23).
Folgerichtig verzichtet Antonovsky in seinem Werk auf eine Eigendefinition der Begriffe Gesundheit oder Krankheit.
2.2 Gesundheitszustand als Ergebnis aus belastenden und schützenden Faktoren
Die Beantwortung der Frage an welcher Stelle eine Person auf dem Gesundheits – Krankheits – Kontinuum anzusiedeln ist, ist das Ergebnis eines interaktiven Prozesses zwischen belastenden und schützenden Faktoren; sogenannten Stressoren und Widerstandsressourcen.
Dieses vor dem Kontext der Lebenserfahrungen einer Person (vgl. Waller o.J.: 22).
Es stellt sich also die Frage: Was sind Stressoren und was sind Widerstandsressourcen?
2.2.1 Belastende Faktoren (Stressoren)
Stressoren sind Reize die auf den Organismus einwirken und in diesem zunächst einen physiologischen Spannungszustand generieren. Entscheidend ist nunmehr wie der Organismus mit diesem Spannungszustand umgeht; d.h. inwiefern die Stressbewältigung gelingt. Sofern das Spannungs- oder Stressmanagement erfolgreich ist tritt eine gesundheitsförderliche Wirkung zu Tage und sofern die Stressbewältigung misslingt ist folglich Stress die Konsequenz (vgl. Bengel et al. 2001: 31 f.).
Dieser Stress kann zu einer Verschiebung auf dem Gesundheits – Krankheits – Kontinnuum Richtung Krankheitspol führen.
Antonovsky unterteilt die Stressoren ferner in drei Gruppen:
- Physische Stressoren
z.B. Auswirkungen von Kriegen, Gewaltakten, Hungersnöten etc.
- Biochemische Stressoren
z.B. Krankheitserreger, Gifte
- Psychosoziale Stressoren
z.B. soziale (Nicht-) Zugehörigkeit
Zu beachten ist hierbei, dass die beiden erstgenannten Gruppen sich allein oder kombiniert meist sehr direkt auf den Gesundheitszustand auswirken (z.B. Messerangriff) währenddessen die Bedeutung der psychosozialen Stressoren langfristig steigt.
Ferner ist das Auftreten von Stressoren die Regel oder in Antonovsky Worten: „Stressoren werden nicht als etwas Unanständiges gesehen, das [sic!] fortwährend reduziert werden muß [sic!], sondern als allgegenwärtig“ (Antonovsky 1997: 30).
[...]