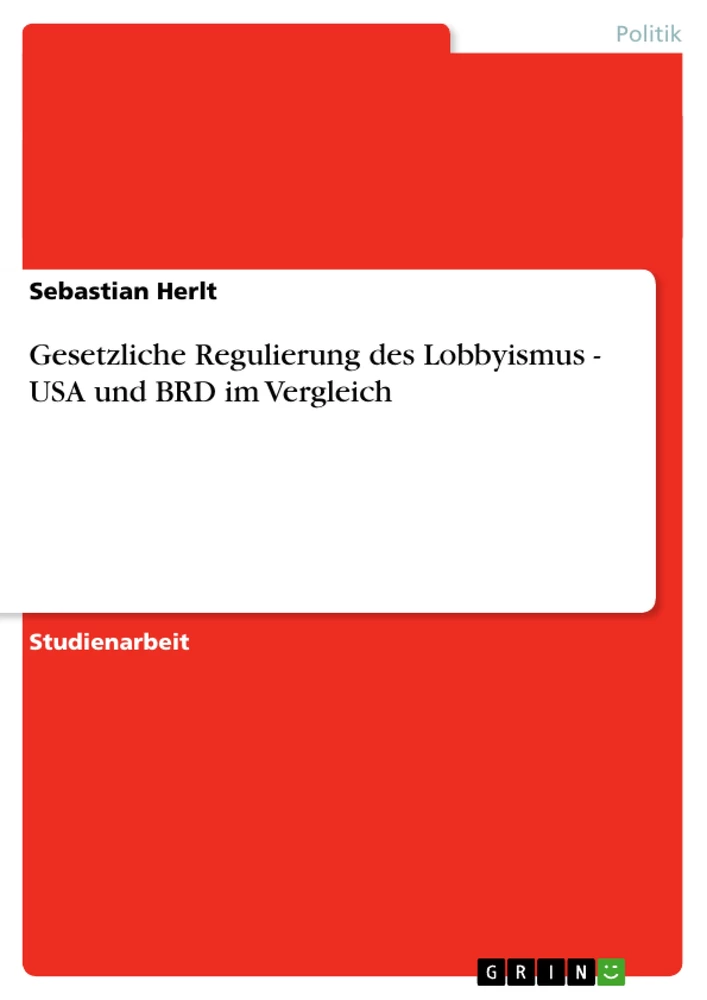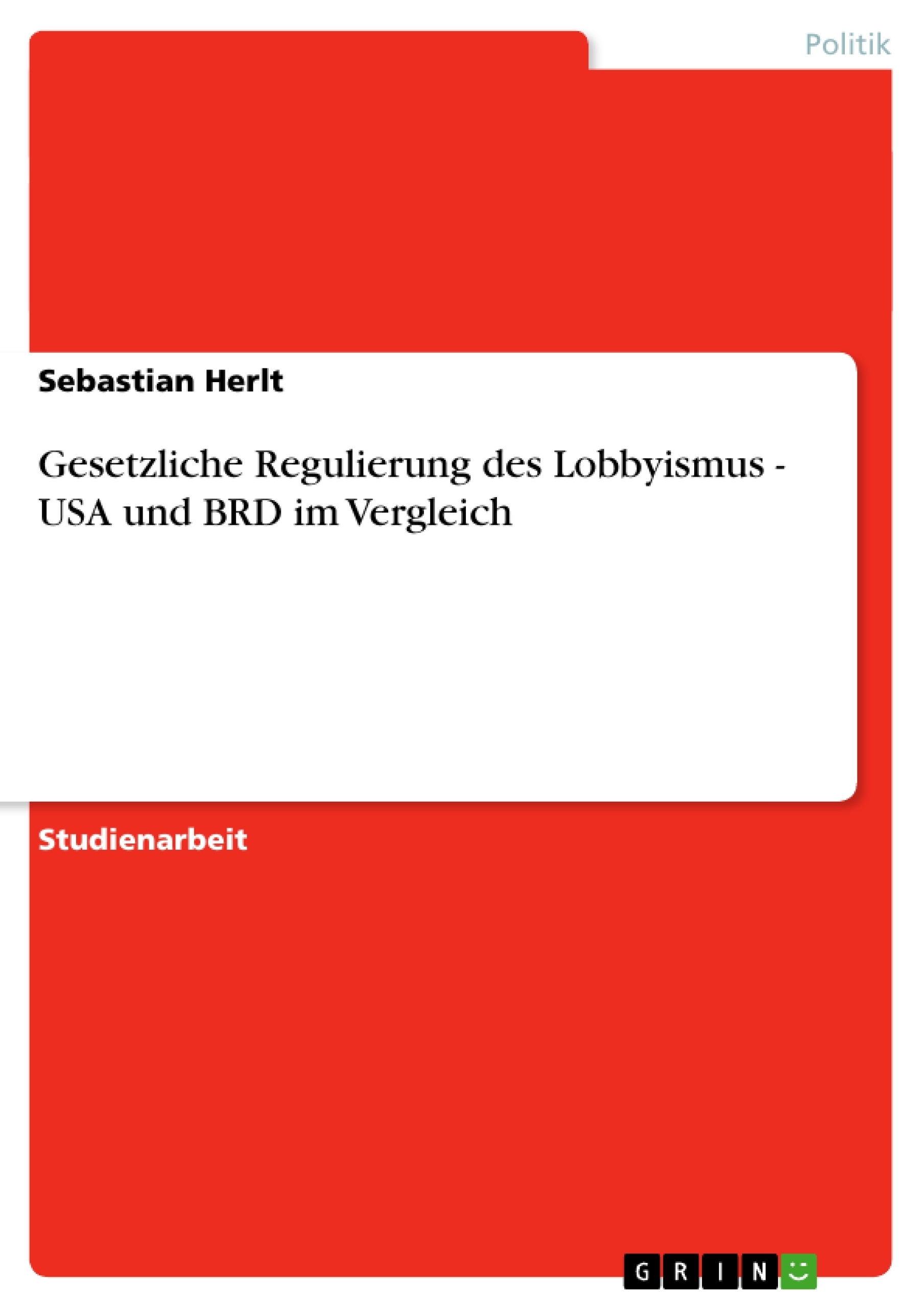Einleitend werden die Begriffe Korporatismus und Pluralismus auf theoretischer und prozes-
sualer Ebene erklärt und ihre Ausformung in den beiden Fallbeispielen USA und Deutschland
kurz erläutert. Folgend werden die einschlägigen, rechtlichen Bestimmungen sowie Grenzen
für die Tätigkeit der Interessengruppen analysiert werden, um in der Schlussfolgerung das
Ergebnis der Untersuchung zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theorie: Pluralismus - Korporatismus
2.1. Pluralismus
2.2. (Neo-)Korporatismus
3. Interessenvermittlungsstrukturen
3.1. Interessenvermittlung in den USA
3.2. Interessenvermittlung in der BRD
4. Gesetzliche Regulierungen der Interessenvermittlung
4.1. Lobbyregulierungen in den USA
4.1.1. Lobbying Disclosure Act
4.1.2. Revolving Door-Act
4.1.3. Ethics Reform Act
4.1.4. Foreign Agents Registration Act
4.2. Lobbyregulierungen in der BRD
4.2.1. Grundgesetz
4.2.2. Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages
4.2.3. Strafgesetzbuch
4.2.4. Parteiengesetz
5. Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Mit der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika scheint eine neue Ära in der politischen Interessenvermittlung in Washington anzubrechen. Die USA stehen vor großen Herausforderungen und brauchen tiefgreifende Reformen in der Gesundheits-, Energie- und Finanzpolitik. Der designierte US-President Barack Obama kündigte weitreichende Politikwechseln an und erklärte den etablierten Lobbygruppen den Kampf mit der Äußerung: „The system we have now might work for the powerful and well-connected interests that have run Washington for far to long [...] I know these steps won’t sit well with the special interests and lobbyists who are invested in the old way of doing business, and I know they ’re gearing up for a fight.” Obama said. “My message to them is this: So am I.“[1] Angesichts der Personalentscheidungen seine Regierungsmannschaft[2] betreffend, scheint ein radikaler Wechsel im amerikanischen Interessenvermittlungssystem wenig wahrscheinlich. Der Fakt, dass der US-amerikanische Präsident sich direkt gegen die Lobbygruppen der Wirtschaftsunternehmen in den Reformfeldern wendet, ist bemerkenswert und zeigt die starke Bedeutung der Interessegruppen im politischen System der USA an. Aber auch in Deutschland wird der Einfluss der interessengeleiteten Politikberatung als bedrohlich wahrgenommen. Schätzungsweise 5.000 Lobbyisten sind in Berlin rund um das Regierungsviertel ansässig und allein über 2000 Interessenverbände haben sich beim Bundestag angemeldet. In den letzen Jahren expandierte die Interessenvermittlungsbranchen in einer für die Bundesrepublik bis dahin beispiellos schnellen Art und Weise. Unlängst forderten kritische Beobachter ein verpflichtendes Lobbyregister für die Branche. Dieses soll nach US-amerikanischen Vorbild nicht nur öffentlich zugänglich sein, sondern auch konkrete Auskunft über die eingesetzten Finanzmittel der Lobbyisten geben. Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten als Mutterland des modernen Lobbyings und das amerikanische System stützt sich auf eine pluralistische Interessenvertretungskultur, in der den interest groups eine große Bedeutung zukommt. Die Bundesrepublik Deutschland hingegen kann auf eine korporatistische Tradition zurückblicken, in der die Interessengruppen wesentlich stärker institutionell eingebunden sind als dies in Amerika der Fall ist. Allerdings bedienen sich immer mehr Interessengruppen in Deutschland ähnlicher Arbeitsmethoden wie die Vereinigungen in den USA. Die stark wachsende Zahl der Lobbyagenturen und Unternehmensrepräsentanzen in Berlin erhöhen den Wettbewerb zwischen den Interessen und nicht nur Kritiker des Lobbyismus verlangen nach strengeren „Spielregeln“ in Deutschland. Die Forderungen zeigen wie kontrovers die Debatte um Regeln in der Interessenvermittlung geführt wird und verschleiern die Tatsache, dass es bereits eine Reglementierung für interessengeleitete Politikberatung/Lobbying in Deutschland gibt. Diese Hausarbeit wird sich mit den rechtlichen Bestimmungen der Interessenvermittlung in Deutschland und den USA auf Bundesebene beschäftigen und vor allem die Organe der Legislative als Lobbyadressat berücksichtigen.[3] Dabei sollen die Regelungen verglichen und daraus allgemeine, systemimmanente Aussagen abgeleitet werden. „Lobbying“ oder interessengeleitete Politikberatung sollen, trotz der funktionalistischen Verschiedenheiten, begrifflich gleichgesetzt werden. Im Speziellen sind alle diejenigen Interessengruppen gemeint, die zwar kein verfassungsmäßiger Teil der staatlich-institutionellen Gewalt sind, aber auf lokaler oder nationaler Ebene versuchen am politischen Prozess beeinflussend mitzuwirken.[4] In Abgrenzung dazu sollen nicht die gebündelten Einzel- und Gruppeninteressen der Parteien untersucht werden, die auf ihre Weise Interessengruppen repräsentieren.[5] Adressaten des Lobbying sind folglich alle Einrichtungen und Institutionen, die politische Entscheidungen vorbereiten, ausführen und kontrollieren. Grundlage des Vergleichs soll die Behauptung sein, dass pluralistische Systeme durch den freien Konkurrenzkampf der Interessengruppen wesentlich striktere rechtliche Rahmen für Lobbying besitzen, als dies in korporatistischen Demokratien der Fall ist.
Einleitend werden die Begriffe Korporatismus und Pluralismus auf theoretischer und prozessualer Ebene erklärt und ihre Ausformung in den beiden Fallbeispielen USA und Deutschland kurz erläutert. Folgend werden die einschlägigen, rechtlichen Bestimmungen sowie Grenzen für die Tätigkeit der Interessengruppen analysiert werden, um in der Schlussfolgerung das Ergebnis der Untersuchung zu erläutern.
Der Literaturstand zum Lobbyismus in Deutschland ist geprägt von einer Zweiteilung zwischen praxisorientierten Arbeitsbüchern und kritisch orientierten, wissenschaftlichen Publikationen. Lange Zeit war die Verbandsforschung in diesem Bereich tonangebend. Mit den Veränderungen in der deutschen Interessenkultur und der Europäisierung finden sich jedoch immer mehr wissenschaftliche Publikationen zum Thema Lobbying im deutschsprachigen Raum. Im besonderen Maß wurden die Monografien von Gert-Joachim Glaeßner, Marco Althaus und Manfred Schmidt herangezogen. Für die Untersuchung der Lobbyregeln in den USA und der BRD wurden zum einen Normen, Gesetzeskommentare und Dokumente des Bundestages, des US-Repräsentantenhauses sowie verschiedener Interessengruppen, Printmedien und Onlinequellen herangezogen.
2. Theorie: Pluralismus - Korporatismus
Pluralismus und Korporatismus sind die beiden großen theoretischen Strömungen, mit denen Politikwissenschaftler die Bedeutung der organisierten Interessen in demokratischen Systemen zu erklären versuchen. Diese Ansätze bildeten sich als Reaktion auf die Entwicklung der modernen Interessengruppen und beinhalten sowohl eine normative, als auch eine deskriptive Dimension. Aus politisch-philosophischer Sicht sollen Normen als das Verhältnis zwischen Staat, als politisch-territoriale Organisation der Gesellschaft und den die Gesellschaft konstituierenden Individuen mit ihren verschiedenen Ambitionen gesetzt werden. Die empirisch deskriptive Seite untersucht dagegen die Organisation und die Vermittlung von Interessen sowie deren Einfluss auf politische Prozesse.[4]
2.1. Pluralismus
Aus normativer Sicht ist der Pluralismus eine Reaktion auf die Moderne. Zentrum der Theorie ist die Anerkennung einer natürlichen Vielzahl von widerstreitenden Fraktionen und Partikularinteressen in der Gesellschaft, die sich in einer Meinungs-, Interessen- und Organisationsvielfalt ausdrücken.[6] Es besteht ein normativer Konsens über die aktive Rolle der frei organisierten Interessengruppen bei der inhaltlichen Politikgestaltung in der Demokratie. Die Chance des Einzelnen, über eine Vielzahl von unterschiedlichen Interessengruppen auf die politische Entscheidungsfindung Einfluss zu nehmen, wird betont. Die Gruppierungen realisieren damit einen wichtigen Teil der Volkssouveränität.[7]
Im Fokus des Pluralismus steht die Fülle der gesellschaftlichen Kräfte und nicht die Einheit des Staates. Schlüsselfaktor des politischen Pluralismus ist das Subsidiaritätsprinzip, welches ein minimales Normensystem konstatiert und alle gesellschaftlichen Entscheidungen, die nicht zwingend auf der allgemeinen-politischen Ebene getroffenen werden müssen, in die Regelungsverantwortung der gesellschaftlichen Organisationen übergibt.
Die Interessengruppierungen konkurrieren in einem freien Wettbewerb um gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Macht, indem sie selbstständig versuchen ihren Einfluss in den politischen Prozess einzubringen und auf staatlicher Ebene durchzusetzen.[8] Dabei sind die Konkurrenten theoretisch gleichberechtigt und an eine Waffengleichheit gebunden. Die gleichstarken Gegenorganisationen stehen in einer intensiven Interdependenzbeziehung und begrenzen sich durch ihre Interessenverfolgung selbst. Dies führt zu einer Pattsituation, in der sich die diversen Gruppierungen, wie etwa Arbeitgeber und Gewerkschaften, gegenseitig kontrollieren. Das politische System ist dabei nicht nur Ziel der Einflussnahme, sondern auch Arena der Konfliktaustragung und durch rechtsstaatliche Regelungen definiert. Notwendig für das friedliche Wettstreiten ist die Anerkennung des Ordnungsrahmens (nicht strittiger Sektor) durch die Akteure. Anders als im klassischen Pluralismus betont der Neopluralismus nach Ernst Fraenkel die Rolle des Staates als unabhängiger Schiedsrichter in einem stärkeren Maße. Der Staat wird in seiner Bedeutung herausgehoben, indem Fraenkel ihm eine übergeordnete Rolle zuschreibt und nicht bloß als weiteren Interessenakteur definiert. Fraenkel bezieht sich in seinen theoretischen Überlegungen auf die Kritik am klassischen Pluralismus und hinterfragt das theoretische Machtgleichwicht sowie die Chancengleichheit der Interessen in der Praxis, da die diversen Lobbygruppen verschiedene Organisations- und Konfliktfähigkeiten aufweisen.[9] Die Konfliktfähigkeit entspricht der Fertigkeit einer Organisation kollektiv die Leistungserbringung zu verweigern oder eine systemrelevante Leistungsverweigerung anzudrohen. Eine weitere Grundannahme des (Neo-)Pluralismus ist die „a-posteriori“ Gemeinwohldefinition. Das Wohl der Allgemeinheit kristallisiert sich erst nach dem Austausch aller vorhandenen gesellschaftlichen Standpunkte und nach einer Kompromissentscheidung zwischen den Interessen aus dem Interessenwettstreit heraus.[10] In diesem Aspekt stimmt der theoretische Neopluralismus mit den Annahmen des Korporatismus überein. Beide Konzepte leh- nen die „a priori“ Festlegung des Gemeinwohl, im Sinne einer unabhängigen Größe durch staatliche Instanzen ab. Weiterhin stimmen beide Theorien darin überein, dass der Parteienwettbewerb als alleinige Willensbildungsarena nicht ausreicht und alle gesellschaftlichen Gruppierungen am politischen Prozess teilnehmen sollten. Pluralistische Systeme sind durch eine starke Autonomie der organisierten Interessen gekennzeichnet. Die Interessengruppen sind meist dezentral organisiert, regional und lokal verortet. In der Regel bilden die überdurchschnittlich vielen Interessengruppierungen Themennetzwerke, in denen sie sich losen issue coalitions zusammenschließen.
Abbildung 1: Interessenvermittlung im Pluralismus
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
2.2. (Neo-)Korporatismus
Das Konzept des Korporatismus hat seine Wurzeln im Pluralismus und eines Systems ver- bandlich organsierter Interessen.[11] Der Korporatismus als System der Interessenvermittlung beinhaltet eine begrenzte Anzahl an nicht miteinander konkurrierenden, singulären Zwangsverbänden. Diese nicht-staatlichen Organisationen sind hierarchisch strukturiert und unterscheiden sich nach ihren funktionalen Aufgaben. Das Konzept des Korporatismus beinhaltet eine Form der Konfliktregulierung, in denen gesellschaftliche Organisationen zur Zusammenarbeit und zu Zugeständnissen gegenüber Regierung und konkurrierenden Interessen fähig und bereit sind. Die Spitzenverbände und Interessenorganisationen sind in ein kartelliertes Netzwerk politischer Willensbildung eingebunden, um gemeinsam mit und unter Leitung der Politik Kompromisslösungen für allgemeinverbindliche Fragen zu finden.[12] Der klassische Korporatismus geht hierbei von einem tripartistischen Verhandlungssystem mit Staat, Unternehmerverbände und Gewerkschaften aus, in denen die Interessen zwangsweise organisiert sind. Wohingegen der Neokorporatismus jegliche Formen der politischen Kooperation frei organisierter Lobbygruppen untereinander und mit den staatlichen Stellen beinhaltet. Grundlogik der „kooperativen Krisenbewältigung“ ist die Vermutung, dass durch die Integration einer begrenzten Anzahl von Akteuren, die über eine umfassenden Repräsentanz verfügen, der Koordinations- und Implementationsaufwand geringer gehalten und eventuelle Konflikte minimiert werden können.[13] Das erhöhen der Regierbarkeit geht allerdings zu Lasten von weniger gut organisierten oder neuaufkommenden Interessen und schafft geschützte Kartelle in denen ausgesuchte Verbände einen privilegierten Zugang zur Politik haben. Graham K. Wilson, der sich auf Schmitters Korporatismustheorie bezieht, definierte sechs Voraussetzungen für das Entstehen von korporatistischen Politikstrukturen. In jedem sozialen Sektor muss es eine Interessengruppe oder zumindest eine nahe gelegene Interessenkoalition geben (z.B.: Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Wohlfahrtsverbände etc.). Diese Akteure müssen von den jeweiligen Angehörigen der Kategorien als Vertreter ihres Klientel akzeptiert werden und genügend Durchsetzungsbefugnis besitzen, um allgemein verbindliche Entscheidungen in ihrem Feld zu implementieren. Dies bedingt eine enge Bindung der Klientelmitglieder an die organisierte Interessenleitung. Alle wichtigen Entscheidungen werden durch das politische Etablissement in Abstimmung und Konsultation mit den Repräsentanten der großen Hauptinteressengruppen getroffen.
Das korporatistische System beeinflusst und kontrolliert das Verhalten der Politik und der Hauptinteressengruppen. Die getroffenen Handlungsentscheidungen dürfen nicht nur, wie in einem pluralistischen Entscheidungssystem, die Politik verändern, sondern müssen auch das Verhalten der Interessengruppen determinieren. Die korporatistischen Entscheidungen sind im Kern vor allem aktive politische Steuerung und Angelegenheiten von „decision-makers“, mit einem geringen Bezug auf legislative Handlungszwänge. Der Staat ist als Lenker und Moderator aktiv und reglementiert im Bereich der Privatwirtschaft das makroökonomische Mana-
[...]
[1] Babington, Charles 2009: Obama says he’s ready to take on lobbyists, in: The Boston Globe vom 01.03.09, unter: www.baston.com/news/nation/articles/2009/03/01/obama_says_hes_ready_to_take_on_lobbyists/, Zugriff: 24.03.09.
[2] Vizeverteidigungsminister Gorden R. England hat für den Rüstungskonzern Raython und der designierte Stabschef des Finanzministeriums Mark Petterson hat für Goldman Sachs Lobbyarbeit betrieben.
[3]
Die Rechtlichen Bestimmungen sorgen für die Wahrung der demokratischen Entscheidungsfindung und sollen eine ungleiche sowie illegitime Einflussverteilung der Lobbygruppen auf den Willensbildungsprozess verhindern. Die Regelungen erstecken sich sowohl auf politische Akteure, die Adressaten von Lobbying sein können, als auch auf die Interessenvertreter selbst.
[4] Köppl, Peter 2005: Lobbying, in: Althaus, Marco; Geffken, Michael; Rawe, Sven 2005 (Hrsg.): Handlexikon Public Affairs, Münster: LIT-Verlag, S. 191f.
[5] Waas, Lothar R. 2007:Gemeinwohl a posteriori oder a priori? In: Bandelow, Nils C.; Bleek, Wilhelm 2007 (Hrsg.): Einzelinteressen und kollektives Handeln in modernen Demokratien, Wiesbaden: VS-Verlag, S. 242.
[6] Massing, Peter 2006: Die Stille Macht der Verbände in Deutschland, in: Koch-Baumgarten, Sigrid; Rütters, Peter 2006 (Hrsg.): Pluralismus und Demokratie. Siegfried Mielke zum 65. Geburtstag, Frankfurt a.M.: BundVerlag, S. 118.
[7] Straßner, Alexander 2006: Funktion von Verbänden in der modernen Gesellschaft, in: APuZ 15-16/2006 vom 16.04.2006APuZ 15-16/2006 vom 16.04.2006, Bonn: bpb, S. 11.
[8] Woyke, Wichard 2000: Pluralismus, in: Andersen, Uwe; Woyke, Wichard 2000 (Hrsg.): Handwörterbuch des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland, 4. Überarbeitete Auflage, Opladen: Leske+Budrich, S. 461.
[9] Kaiser, Christian 2006: Korporatismus in der Bundesrepublik Deutschland. Eine politikfelderübergreifende Übersicht, Marburg: Metropolis-Verlag, S. 27.
[10] Massing 2006: S. 119.
[11] Kaiser, Christian 2006: S. 88.
[12] Glaeßner, Gert-Joachim 2006: Politik in Deutschland, 2. aktualisierte Auflage, Wiesbaden: VS-Verlag, S. 474f.
[13] Reutter, Werner 1990: Korporatismustheorien - Kritik, Vergleich, Perspektiven, Frankfurt a. M.: Verlag Peter Lang, S. 82f.