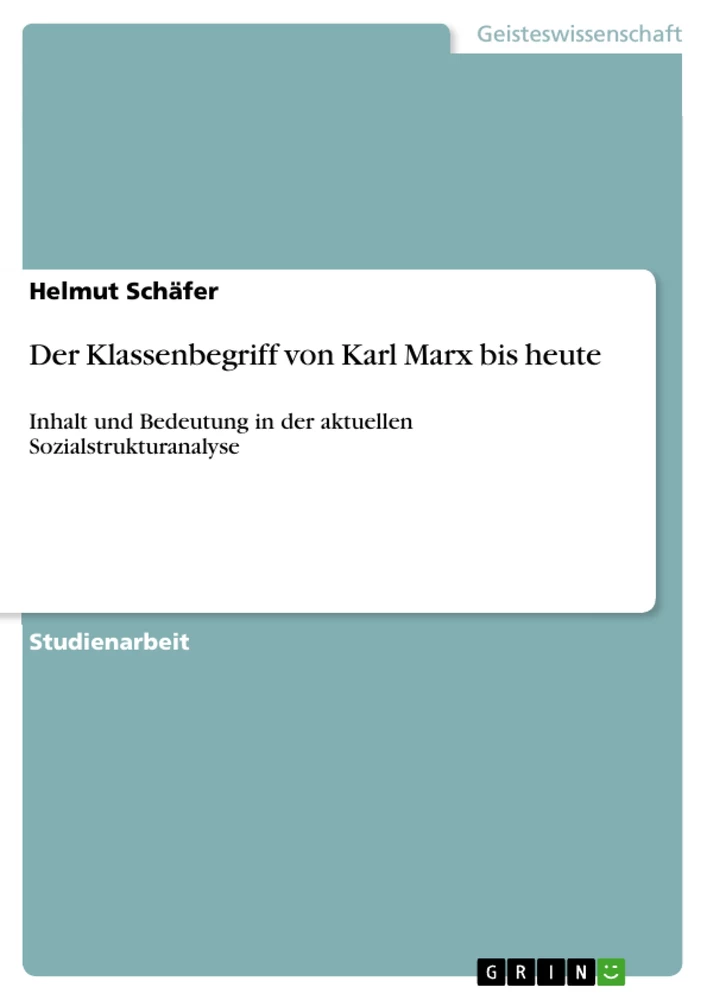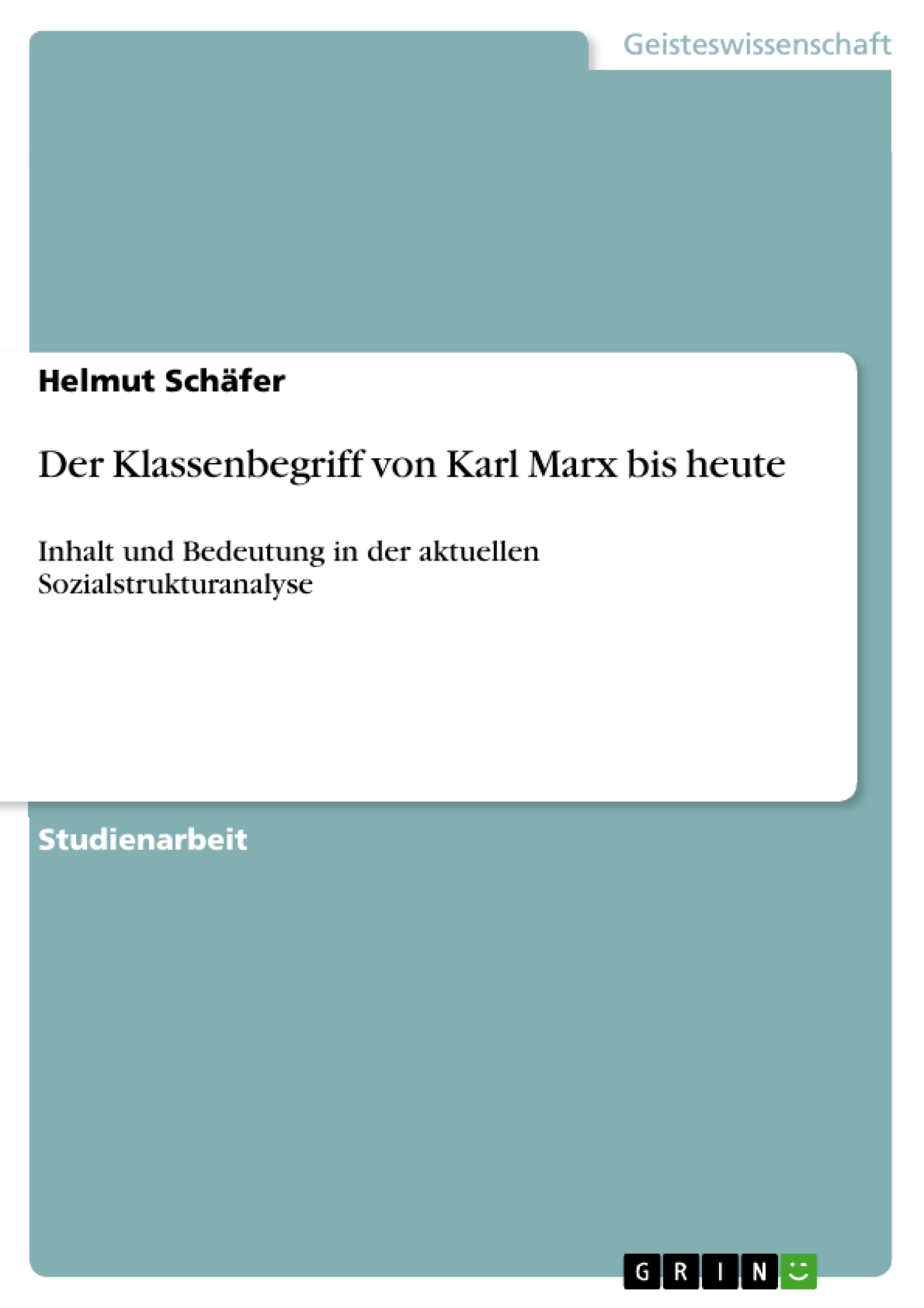"Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen"
Diese Aussage von Karl Marx und Friedrich Engels am Beginn des Manifests der Kommunistischen Partei setzt einen bestimmten Klas-senbegriff voraus. Die politische Bedeutung des von den beiden Theoretikern entwickelten Modells und die daraus entstandenen gesellschaftlichen Folgen sind noch heute, 150 Jahre später wirksam.
Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, ausgehend vom Begriff der Klasse im Sinn von Marx und Engels, einen Vergleich zwischen einem herkömmlichen soziologischen Theorieansatz und neueren Modellen und Methoden zur Untersuchung sozialer Un-gleichheiten herzustellen. Auf eine umfangreiche Beleuchtung des zweiten Schwerpunktes bisheriger Konzeption von Sozialstruktur-analyse, das vor allem von Max Weber geprägte Schichtmodell, wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.
Zunächst wird die Frage zu stellen sein, wie Marx und Engels den Begriff der Klasse definieren (Kapitel 2). Dies geschieht hier anhand einer Analyse des eingangs zitierten Manifests. Die Begrenzung auf eine Quelle des umfangreichen Gesamtwerkes der beiden Autoren erscheint für den Rahmen dieser Arbeit notwendig und auch angemessen, da hier der Kern des zu untersuchenden Klassenbegriffs sehr deutlich herausgearbeitet werden kann.
Im Folgenden (Kapitel 3 u. 4) ist dann zu untersuchen, ob und in-wieweit die Marxsche Theorie in der aktuellen Soziologiediskussion noch Gültigkeit hat, mit welchen Kategorien und Indikatoren beispielsweise neomarxistische Wissenschaftler bei der Analyse von Gesellschaftsstrukturen arbeiten. Es wird aber auch zu fragen sein, ob es sich bei den neueren Theorieansätzen nicht nur um eine Modifikation der herkömmlichen Modelle handelt, die einer sehr stark differenzierten Gesellschaft dadurch gerecht zu werden vorgeben, dass sie alte Begriffe durch komplexere Terminologien ersetzen, die letztendlich das gleiche Phänomen beschreiben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitende Vorbemerkung
2. Der Klassenbegriff bei Karl Marx und Friedrich Engels
2.1. Das Manifest der Kommunistischen Partei
2.2. Die Entstehung von Klassen
2.2.1. Die Geschichte von Klassenkämpfen
2.2.2. Polarisierung und innere Unterscheidung
2.3. Das Klassenbewusstsein
2.3.1. Das Klassenbewusstsein „an und für sich“
2.3.2. Die Rolle des Individuums innerhalb seiner Klasse
2.4. Der Klassenkampf und die klassenlose Gesellschaft
3. Versuch einer Analyse der theoretischen Weiterführung des kommunistischen Klassenbegriffs
3.1. Neomarxistischen Klassenanalyse bei Eric Olin Wright
3.1.1. Diskussionsstand in der marxistisch orientierten Wissenschaft
3.1.2. Das Problem einer Einordnung der Mittelschicht
3.1.3. Die beiden Klassenmodelle von Wright
3.2. Empirische Untersuchungsergebnisse aus der Bundesrepublik Deutschland
4. Marxistische Sozialstrukturtheorie in der aktuellen Soziologiediskussion: Ein Vergleich zwischen einem herkömmlichen und neueren Ansätzen
4.1. Kernpunkte der neueren Theorieansätze im Vergleich zum kommunistischen Klassenmodell
4.2. Kritik an den herkömmlichen, vertikalen Theorieansätzen zur sozialen Ungleichheit
4.2.1. Gemeinsame Grundlagen der traditionellen Theorieansätze und deren Unzulänglichkeit
4.2.2. Bedingungen für die Kritikresistenz vertikalerGesellschaftsmodelle
5. Zusammenfassung und abschließende Stellungnahme
Literaturverzeichnis
1. Einleitende Vorbemerkung
"Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen"[1]
Diese Aussage von Karl Marx und Friedrich Engels am Beginn des Manifests der Kommunistischen Partei setzt einen bestimmten Klassenbegriff voraus. Die politische Bedeutung des von den beiden Theoretikern entwickelten Modells und die daraus entstandenen gesellschaftlichen Folgen sind noch heute, 150 Jahre später wirksam.
Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, ausgehend vom Begriff der Klasse im Sinn von Marx und Engels, einen Vergleich zwischen einem herkömmlichen soziologischen Theorieansatz und neueren Modellen und Methoden zur Untersuchung sozialer Ungleichheiten herzustellen. Auf eine umfangreiche Beleuchtung des zweiten Schwerpunktes bisheriger Konzeption von Sozialstrukturanalyse, das vor allem von Max Weber geprägte Schichtmodell, wird an dieser Stelle bewusst verzichtet.
Zunächst wird die Frage zu stellen sein, wie Marx und Engels den Begriff der Klasse definieren (Kapitel 2). Dies geschieht hier anhand einer Analyse des eingangs zitierten Manifests. Die Begrenzung auf eine Quelle des umfangreichen Gesamtwerkes der beiden Autoren erscheint für den Rahmen dieser Arbeit notwendig und auch angemessen, da hier der Kern des zu untersuchenden Klassenbegriffs sehr deutlich herausgearbeitet werden kann.
Im Folgenden (Kapitel 3 u. 4) ist dann zu untersuchen, ob und inwieweit die Marxsche Theorie in der aktuellen Soziologiediskussion noch Gültigkeit hat, mit welchen Kategorien und Indikatoren beispielsweise neomarxistische Wissenschaftler bei der Analyse von Gesellschaftsstrukturen arbeiten. Es wird aber auch zu fragen sein, ob es sich bei den neueren Theorieansätzen nicht nur um eine Modifikation der herkömmlichen Modelle handelt, die einer sehr stark differenzierten Gesellschaft dadurch gerecht zu werden vorgeben, dass sie alte Begriffe durch komplexere Terminologien ersetzen, die letztendlich das gleiche Phänomen beschreiben.
2. Der Klassenbegriff bei Karl Marx und Friedrich Engels
2.1. Das Manifest der Kommunistischen Partei
Im November 1847 beauftragte die Internationale Arbeiterbewegung "Bund der Kommunisten" Karl Marx und Friedrich Engels mit der Abfassung eines Parteiprogramms, das sowohl den Mitgliedern der Organisation als auch der Öffentlichkeit die Schwerpunkte der politischen Arbeit aufzeigen sollte. Die erste Veröffentlichung des Werkes erschien im folgenden Jahr in deutscher Sprache. Es folgten dann englische, französische, polnische russische und dänische Ausgaben. In vier Abschnitten setzen sich die Autoren zunächst mit dem wechselseitigen Verhältnis zwischen 'Bourgeoisie und Proletariat', den Unterschieden zwischen 'Proletariern und Kommunisten', der sozialistischen und kommunistischen Literatur sowie der Stellung der Kommunisten zu den übrigen oppositionellen Parteien ihrer Zeit auseinander. In der Vorrede zur deutschen Ausgabe aus dem Jahr 1872 weisen die Verfasser auf eine starke Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse innerhalb der seit der Ersterscheinung vergangenen 25 Jahre hin. Dies lasse vielleicht an manchen Stellen eine Änderung des Programms notwendig erscheinen, der im wesentlichen von Marx stammende Grundgedanke allerdings, habe dennoch allgemeine Gültigkeit, wie Engels später schreibt.[2]
2.2. Die Entstehung von Klassen
2.2.1. Die Geschichte von Klassenkämpfen
Einleitend sei an dieser Stelle bemerkt, dass sich bei Marx trotz seiner zentralen Bedeutung an keiner Stelle eine eindeutige Definition des Klassenbegriffs findet. Man kann allerdings festhalten, dass er ihn in zwei Bedeutungszusammenhängen verwendet. Einerseits umfassend für die Bezeichnung unterschiedlicher Abstufungen innerhalb der verschiedenen Gesellschaftsformen, andererseits spezifisch, wenn er zwischen der Bourgeoisie und dem Proletariat der kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit spricht. Grundsätzlich aber assoziiert er bei der Zuordnung zu einer Klasse immer eine bestimmte Stellung des Individuums innerhalb des Produktionsprozesses, das heißt er unterscheidet zwischen Besitz und Nichtbesitz von Produktionsmitteln.
Mit der Schaffung des Privateigentums nach der Urgesellschaft beginnt schon in der frühen Antike ein ökonomischer Prozess, der die Gesellschaft in Herrschende und Beherrschte, Sklaven und deren Besitzer unterteilt. Im dialektischen Dreischritt entwickelt sich die Gesellschaft über den Feudalismus hin zum Kapitalismus. Jede der drei Phasen wird durch den Kampf der jeweils beherrschten Klasse gegen die Herrschenden beendet und führt zu der darauffolgenden Gesellschaftsform. Dabei ist der auslösende Faktor die zunehmende Divergenz zwischen den dynamischen Produktivkräften und den statischen Produktionsverhältnissen.[3]
2.2.2. Polarisierung und innere Unterscheidung
Gehen Marx und Engels zunächst nur von der globalen Unterscheidung zwischen Herrschenden und Beherrschten aus, so räumen sie doch auch innerhalb dieser Kategorien verschiedene Abstufungen ein: So gibt es beispielsweise innerhalb der Nichtbesitzer von Produktionsmitteln durchaus auch einen Mittelstand, der in seinem Konsumverhalten weniger stark eingeschränkt ist als ein einfacher Tagelöhner. Dennoch stellen sie in ihrer Zeit eine zunehmende Polarisierung fest:
"Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat."[4]
Im weiteren wird dann die Verschärfung dieser Polarisierung beschrieben. Der sogenannte Mittelstand, z.B. kleine und mittlere Handwerker, die bisher als selbstständige Bürger im Rahmen des kapitalistischen Systems zunehmend ihre Unabhängigkeit zugunsten einer immer mächtiger werdenden Industrie einbüßen müssen, verlieren ihr Eigentum und fallen in die Klasse der Proletarier ab. So schrumpft die anfänglich breite Schicht des Bürgertums zu einer kleinen Gruppe immer vermögenderer Kapitaleigentümer zusammen, und es bildet sich eine immer größer werdende Masse von Lohnarbeitern, die zwar zur Kapitalanhäufung den eigentlichen Beitrag leistet, selbst aber davon nur insofern profitiert, dass sie sich selbst gerade noch am Leben halten kann.[5] Bezeichnend für diese Entwicklung ist folgendes Zitat:
"So rekrutiert sich das Proletariat aus allen Klassen der Bevölkerung."[6]
2.3. Das Klassenbewusstsein
2.3.1. Das Klassenbewusstsein „an und für sich“
Marx und Engels unterscheiden zwischen dem Begriff der Klasse 'an und für sich'. Ersteres bezeichnet den objektiven Bestand einer Gruppe mit bestimmten Merkmalen (hier Besitz/Nichtbesitz von Produktionsmitteln). Anhand dieser Merkmale kann jedes Individuum objektiv entweder der Klasse der Bourgeoisie oder der des Proletariats zugeordnet werden. Hierbei muss sich das Individuum dieser Zugehörigkeit aber nicht bewusst sein, es bedarf also keines Bewusstseins für das 'Kollektiv' der Klasse. Die Verschärfung der sozialen Situation allerdings, z.B. niedrige Löhne, ungeregelte Arbeitszeit, fehlende staatliche Sozialhilfemaßnahmen, etc. führen zu einer Bewusstwerdung der sozialen Situation des einzelnen Proletariers. Hierbei entwickelt sich, so Marx, ein Gefühl für die Klassenzugehörigkeit, ein bestimmtes 'Wir-Gefühl' ist die Folge. Daraus wächst ein Bedürfnis zur Veränderung der Lage, der (kollektive) Wunsch nach Veränderung des jeweiligen Systems. Das Klassenbewusstsein 'für sich' beinhaltet demzufolge eine Einsicht in die Notwendigkeit einer Änderung der bestehenden Verhältnisse. Die Arbeiterklasse erkennt ihre Ausbeutung und schließt sich zu einer Bewegung mit praktischen politischen Interessen zusammen.
2.3.2. Die Rolle des Individuums innerhalb seiner Klasse
Es scheint zwischen der Klasse und dem einzelnen Individuum eine wechselseitige Beziehung zu bestehen. Im Proletariat prägt einerseits das gemeinsame Klassenziel, nämlich die Aufhebung der Klassengesellschaft das Denken des Einzelnen, andererseits können aber auch die persönlichen Interessen diesem Ziel entgegenstehen. Ein leitender Angestellter z.B., der an der oberen Klassengrenze steht, wird wahrscheinlich nicht an der Auflösung der bestehenden Gesellschaftsform und dem damit verbundenen Verlust seines relativ hohen Wohlstandgrades interessiert sein. In diesem Fall jedoch, so die Verfasser des Manifests, ordne sich der Einzelwille dem kollektiven unter, entweder durch die Einsicht in die Notwendigkeit oder durch eine Nötigung zur Unterordnung der individuellen unter die kollektiven Interessen. Beim Proletariat äußert sich das Klasseninteresse durch die Organisation in Gewerkschaften und Parteien, das der Bourgeoisie äußert sich im Bekenntnis zum Staat, der zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft durch Gesetze und andere Verordnungen eingerichtet ist. Das Umgehen einiger Verordnungen zugunsten einer persönlichen Bereicherung ist ein Beispiel für die Konfliktsituation des bürgerlichen Individuums gegenüber seinem Klasseninteresse.[7]
[...]
[1] Marx, Karl und Friedrich Engels, 1989, S.19
[2] vgl.:a.a.O., S. 3-5
[3] vgl.: a.a.O., S.19-21
[4] a.a.O., S.20
[5] vgl: a.a.O., S.22-33
[6] a.a.O., S.28
[7] vgl.: Fetscher, Iring (Hrsg), 1976, S.58-63