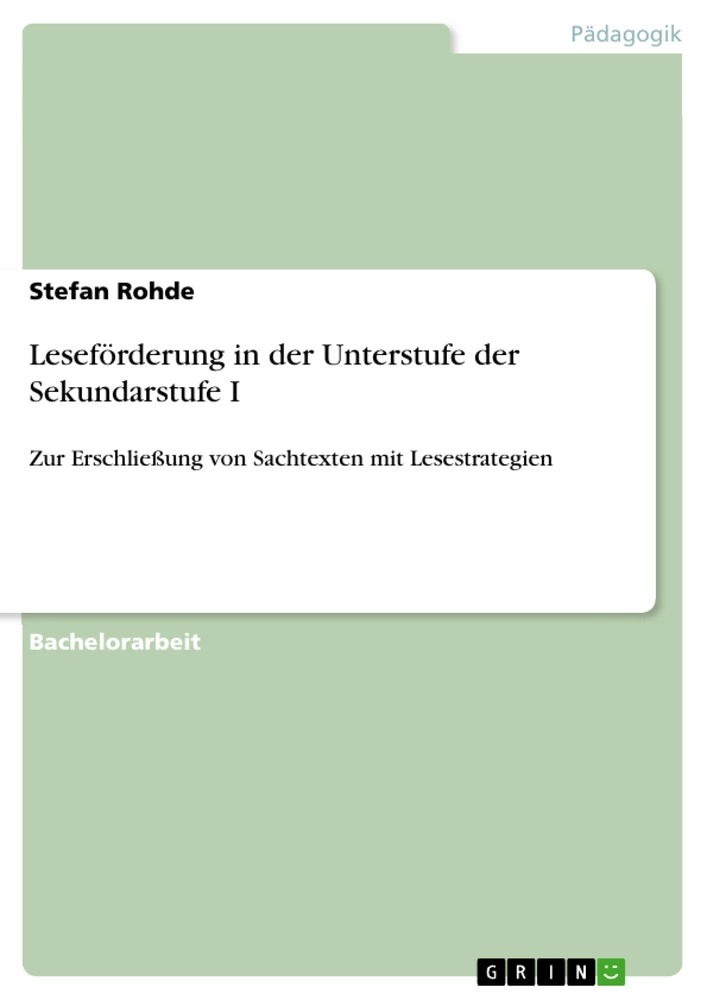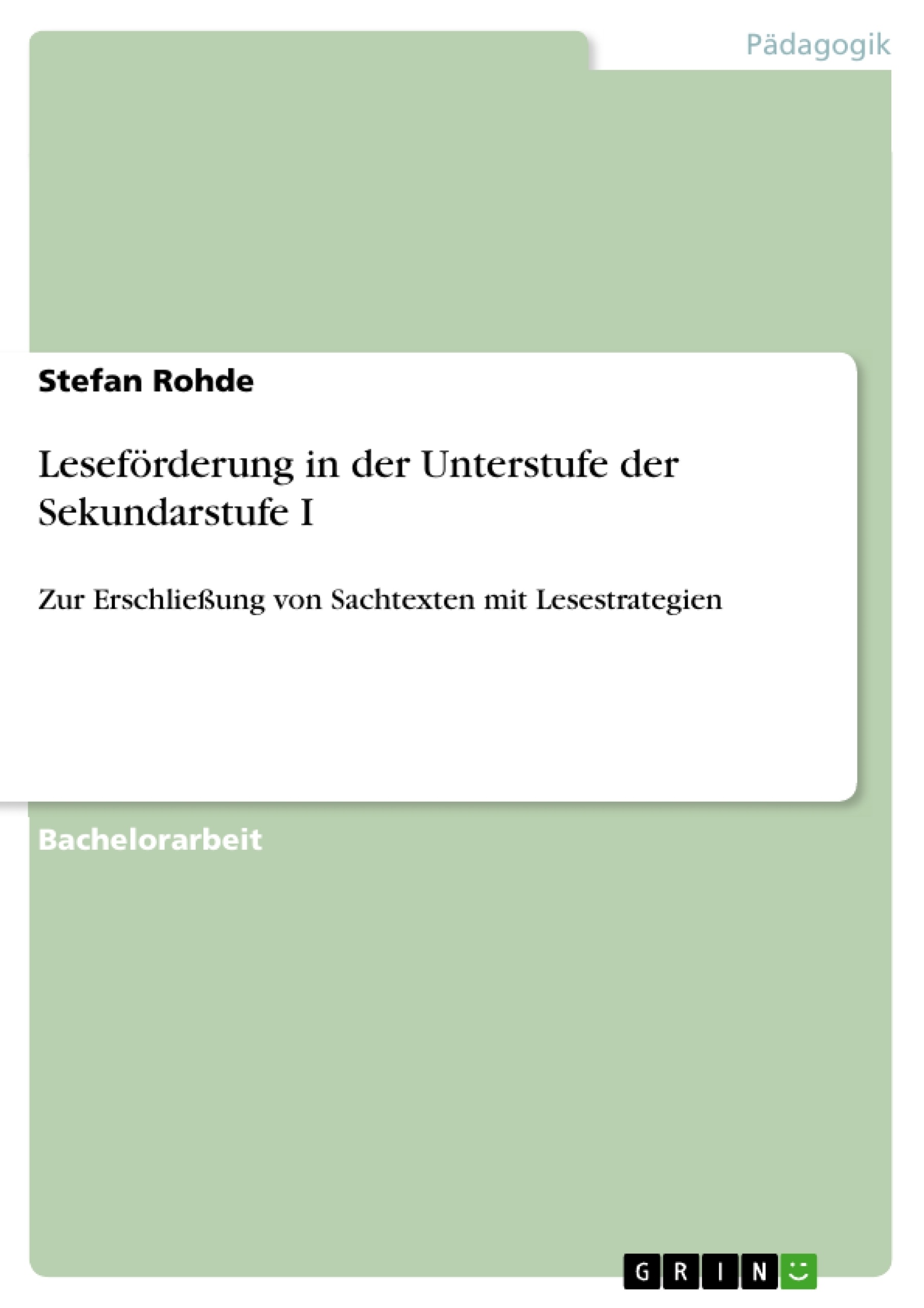„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu ungeträumten Möglichkeiten, zu einem berauschend schönen, sinnerfüllten Leben.“ (Aldous Huxley)
Mit diesem Zitat hat die damalige Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Renate Schmidt die Frankfurter Buchmesse 2004 eröffnet. Die Frage danach, ob Huxleys Ausspruch in multimedialen Zeiten auf Bücher bezogen noch Gültigkeit besitzt, werden viele Schülerinnen und Schüler, die sich mit der schwierigen Erlernung des Lesens konfrontiert sehen, verneinen. Gerade, weil die heutigen SuS die Wahl zwischen dem Medium Buch und anderen Medien wie z. B. Fernsehen, Hörbücher, Internetapplikationen u.v.m. haben, scheint das Buch an sich häufig veraltet. Dennoch steht außer Frage, dass erst schriftliche Medien den Leser zu einer hohen Rezeptionstätigkeit führen, sodass die gelesenen Inhalte produktiver in das mentale Modell des Lesers integriert werden. Hier wird deutlich, dass gerade die Sachtextrezeption von hoher Lesekompetenz profitiert. PISA 2000 hat gezeigt, dass die deutschen SuS häufig nicht in der Lage sind, komplexe Texte selbstständig zu erlesen, zu bearbeiten und zu reflektieren. Hier stellt sich die Frage nach Lösungsstrategien von Seiten der Institution Schule.
Diese Arbeit entwickelt anhand der PISA-Ergebnisse Förderungsansätze, durch die schon in Unterstufe der Sekundarstufe I, die Lesefähigkeit der SuS gesteigert werden kann. Diese zu entwickelnde Leseförderung kann de facto nur gelingen, wenn sich zunächst bewusst gemacht wird, welche Kompetenzbereiche Lesen eigentlich umfasst. Daran anknüpfend wird der Leseprozess unter Bezugnahme auf kognitive Prozesse dargestellt. Um das Sachtextverständnis zu fördern, muss nun abgegrenzt werden, was genau mit Sachtexten gemeint ist und wie sie sich von literarischen Texten unterscheiden.
Erst auf diese theoretischen Hintergründe aufbauend ist es sinnvoll, vorhandene Lesestrategien exemplarisch zu analysieren und zu kritisieren, woraufhin diese eigenen Leseförderungsansätze zum Sachtextverständnis entstehen können. Die Frage, mit der sich die vorliegende Arbeit beschäftigt ist demnach, auf welche Weise es gelingen kann schulinterne Leseförderung zu betreiben und mit welchen Hilfsmitteln ein möglichst umfassendes Konzept zu realisieren ist.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Reading Literacy – Lesekompetenz
2.1 Empirische Grundlegung
2.2 Kompetenzbegriff
2.3 Kognitionstheoretisches Modell von Textverständnis
2.4 Resümee
3 Textgattung: Sachtexte
3.1 Einordnung: Sachtext – literarischer Text
3.2 Probleme beim Sachtextverständnis
3.3 Resümee
4 Praxis: Leseförderung
4.1 Lesestrategien
4.2 „Die Textdetektive“ – exemplarische Darstellung
5 Kritische Auseinandersetzung
5.1 Leseförderung für unterdurchschnittlich schwache Schüler
5.2 Workshop statt Lebensinhalt
5.3 Freude am Lesen
6 Ansätze eines Förderungskonzepts
6.1 Rahmenbedingungen
6.2 Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit
6.2.1 Förderung auf Ebene der hierarchieniedrigen Prozesse
6.2.2 Förderung auf Ebene der hierarchiehohen Prozesse
6.3 Langzeitförderung
6.4 Resümee & Anwendungsbeispiel
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis