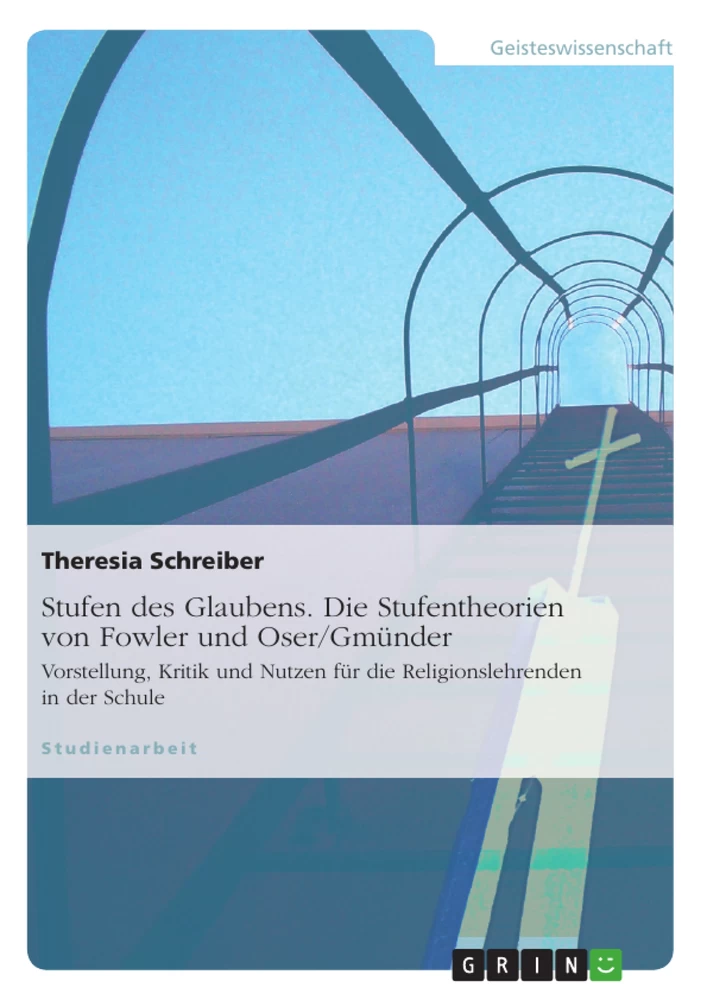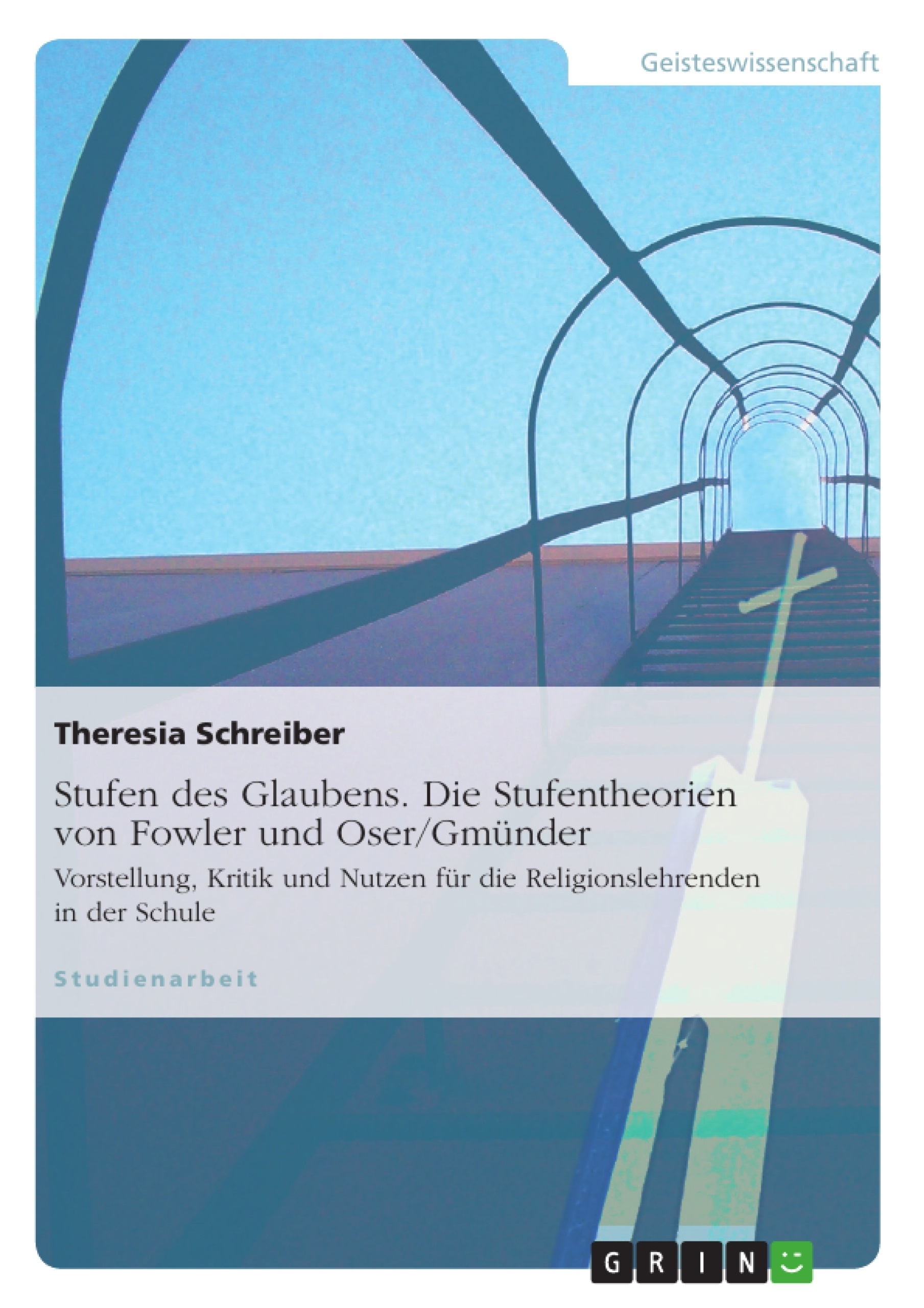Die Stufentheorien von Oser/Gmünder und Fowler zur Entwicklung des religiösen Urteils, die auf Piagets Stufenmodell der kognitiven Entwicklung aufbauen, sind für alle Religionslehrenden interessant. Nützlich ist das Wissen um sie gerade dann, wenn man ihre Aussagen nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern in Übereinstimmung miteinander bringt.
Die Arbeit analysiert, welche Stufen in welchem Alter bei den Lernenden zu erwarten sind und welche didaktischen Folgen dieses Wissen für den Lehrenden haben sollte. Es wird reflektiert, inwiefern das Wissen um die Stufen bei der Unterrichtsplanung und -evaluation einbezogen gewinnbringend werden kann.
Inhalt
Einleitung
1. Jean-Piagets Forschung zur kognitiv-strukturellen Entwicklung
2. Konstruktivistische Theorien über die religiöse Entwicklung
2.1 James Fowler – Die Untersuchungen zur Entwicklung des Glaubens
2.2 Fritz Oser und Paul Gmünder – Die Untersuchungen zur Entwicklung des religiösen Urteils
2.3 Untersuchungsergebnisse von Fowler und Oser/Gmünder
2.3.1 Allgemeine Aussagen
2.3.2 Zu erwartende Stufen bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
a) Vorschulalter
b) Grundschulalter
c) Jugendalter
d) Erwachsenenalter
2.4 Kritik der Untersuchungen
2.4.1 Kritik des Ansatzes „Stufentheorie“
2.4.2 Kritik an den Untersuchungen von Fowler und Oser/Gmünder
3. Schlussfolgerungen für das Handeln der Religionslehrenden
Mit Blick auf die Stufenmodelle zur Entwicklung der Kinder beitragen
Maxime 1: Sich auf die bei Schüler/innen erwartbaren Stufen einstellen
Maxime 2: Die Methodik anhand des Wissens über Entwicklungsstufen ausrichten
Maxime 3: Bei unterrichtlichen Fehlschlägen eine Analyse der Stufensituation in der Klasse in die Evaluation einbeziehen.
4. Resümee
Literatur