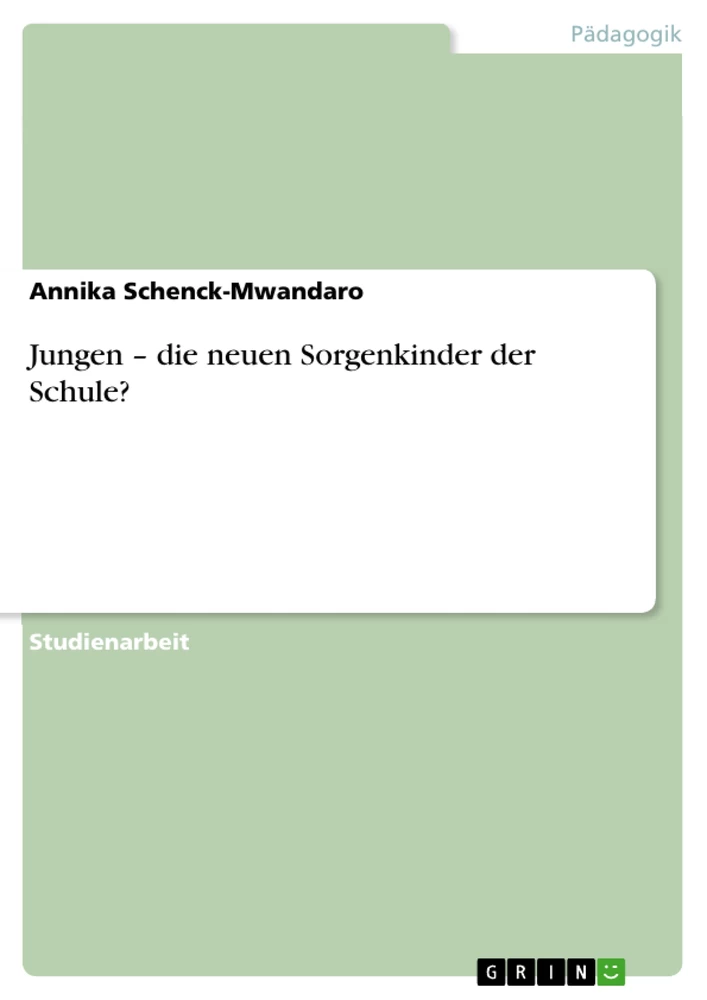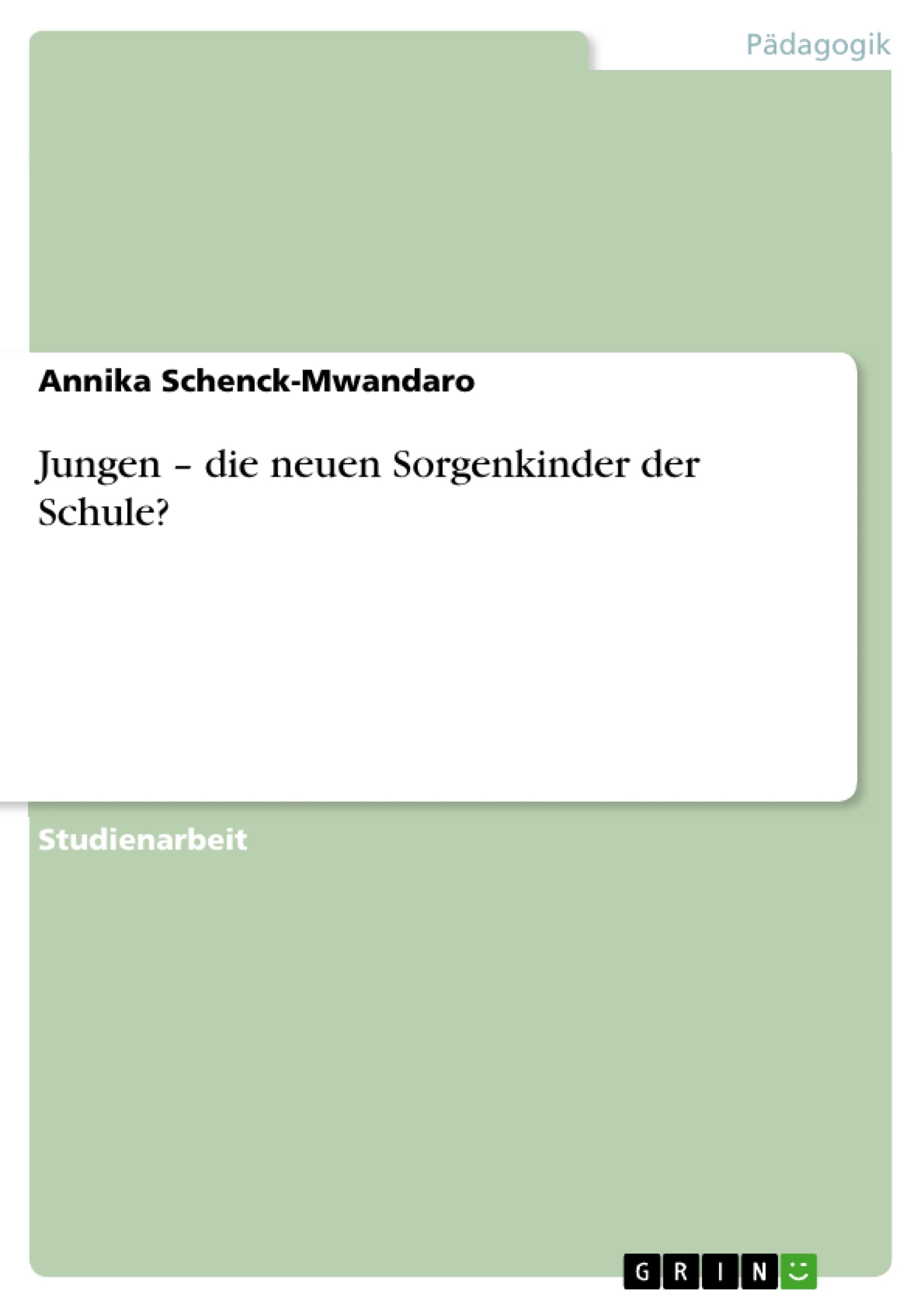1 Einleitung
1.1 Einführung und Zielsetzung
Jungen, das neue schwache Geschlecht? Noch vor gar nicht langer Zeit war es umgekehrt und die Frau galt als das zu fördernde Geschlecht. Im Zuge der Frauenbewegung wurden berechtigterweise zahlreiche Programme eingeführt, die speziell die Mädchen fördern sollten. Die deutsche Bildungspolitik richtete lange ihre Bemühungen nur zugunsten der Mädchen aus. Mädchen bekamen Privilegien. Zwar besetzen Männer auch heute noch immer die meisten Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft, verdienen besser und können laut dem Bestseller von Allan und Barbara Pease besser einparken, aber sind die Jungen immer noch in der Vorreiterposition oder hinkt der männliche Nachwuchs den Mädchen in der Schule hinterher?
Laut der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sollen beide Geschlechter im Schulsystem die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben, denn das Grundgesetz schreibt vor, dass niemand wegen seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen und eben auch wegen seines Geschlechtes, benachteiligt oder bevorzugt werden darf. (vgl. Grundgesetz, 1949, Artikel 3) Aber haben Jungen und Mädchen tatsächlich dieselben Chancen auf eine gute Schulkarriere? Bietet das System Schule Jungen wie Mädchen dieselben Bedingungen? Werden die Fähigkeiten und Potenziale von beiden Geschlechtern gleichviel gefördert? Dieser Frage soll in der vorliegenden Arbeit nachgegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Einfuhrung und Zielsetzung
1.2 Aufbau der Arbeit
2 Sind Jungen die neuen Bildungsverlierer?
2.1 Die Lebenssituation der Jungen von heute
2.2 Daten und Fakten
3 Erklarungsversuche
3.1 Schattenseiten der Emanzipation
3.2 Feminisierung von Schule und Lebenswelt
3.3 Unterricht ist auf Madchen ausgerichtet
3.4 Madchen lernen anders, Jungen auch
4 Wege aus der Misere
4.1 Mannerquote fur Kindergarten und Schule?
4.2 Zuruck zur Monoedukation?
4.3 Geschlechtergerechter Unterricht
5. Zusammenfassung und Fazit
Literaturverzeichnis