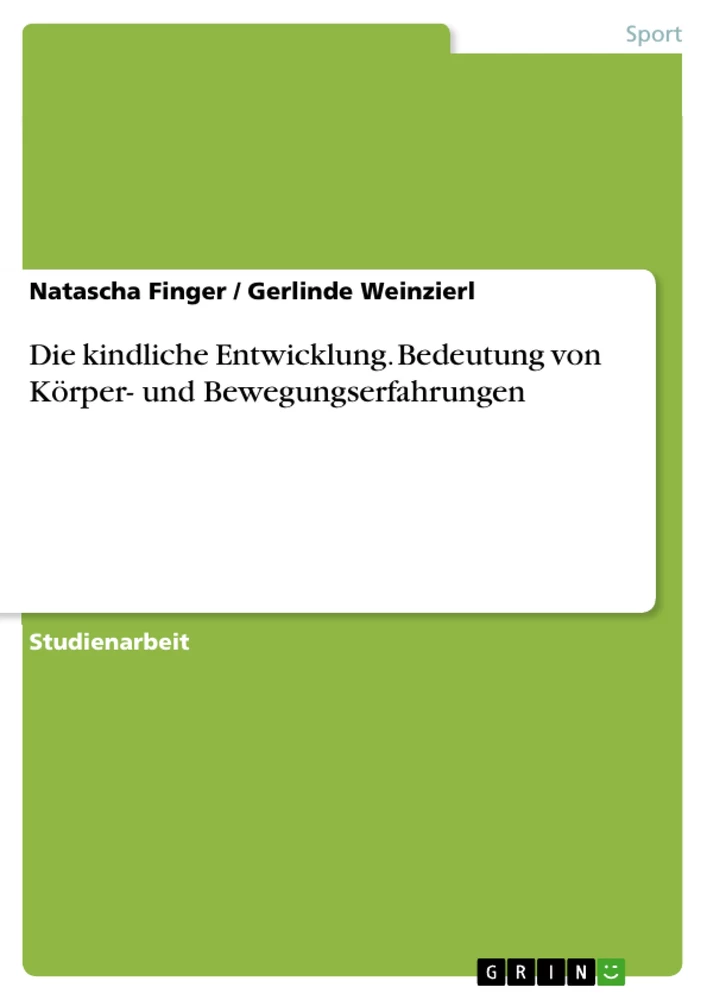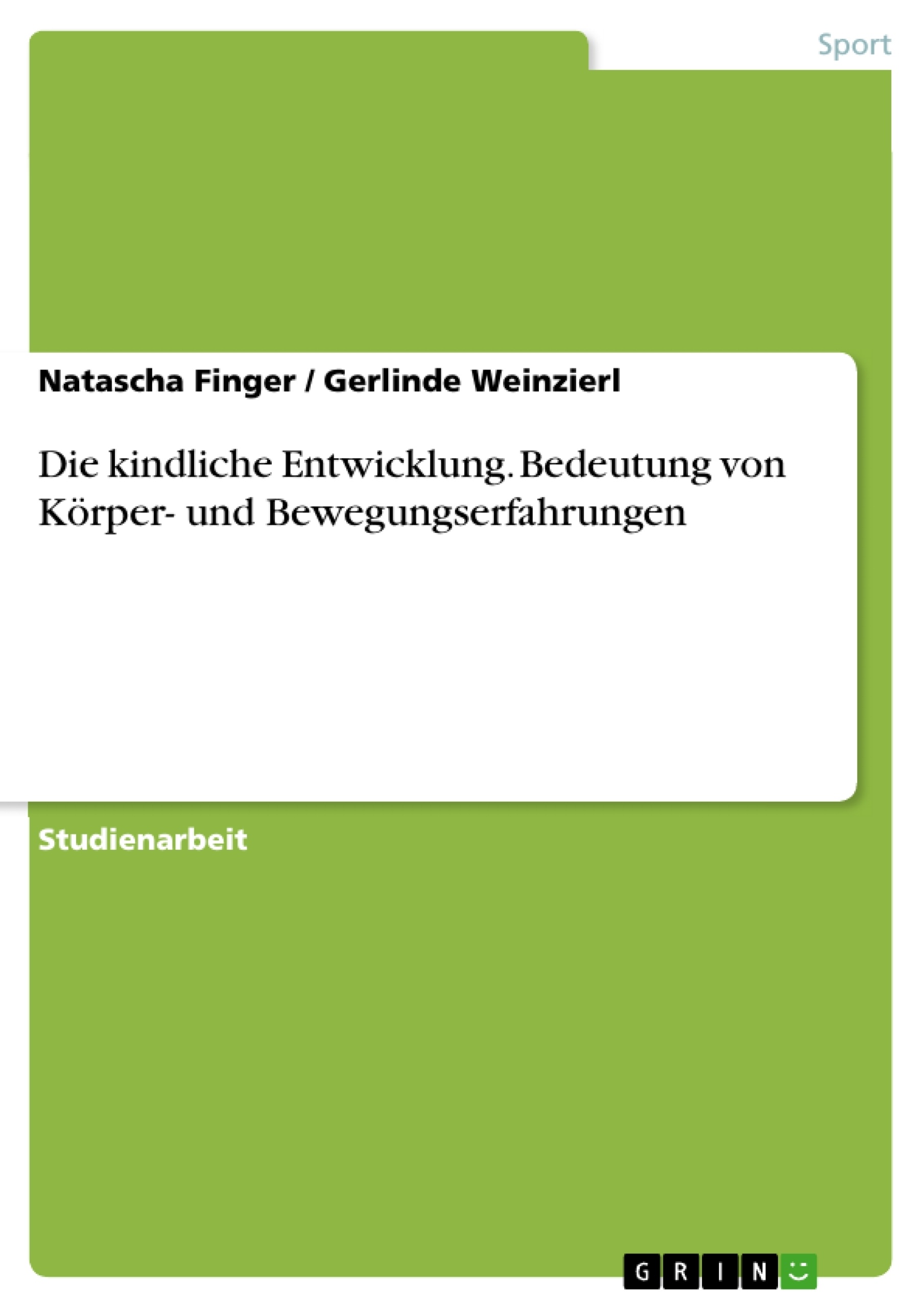Das sportwissenschaftliche Lexikon definiert Bewegung als „Ortsveränderung eines Körpers oder einzelner seiner Teile im Verhältnis zur Zeit“ und erforscht vor allem die damit
zusammenhängenden motorischen Bedingungen.(1)
Biologisch gesehen beruht aktive Bewegung auf „Energiefreisetzung durch den Stoffwechsel des Organismus“(2)
Wenn wir nun aber genauer hinsehen, stellen wir fest, dass die menschliche Bewegung nicht nur eine „Orts- und Lageveränderung“ ist, sondern sie immer auch ihren Sinn und ihre Beweggründe hat.
Hiermit nähern wir uns nun der phänomenologischen Sichtweise, die ganzheitliche Bewegungshandlungen im Sinnzusammenhang des Lebens eines Menschen beschreibt und erklärt. Die Erlebnisgehalte der Bewegung, ihre Ausdruckskraft und ihr dynamischer Ablauf
werden bei dieser Betrachtung eine größere Bedeutung beigemessen, als die physikalische Raum-Zeit-Korrelation.(3)
Bewegung ist aus dieser Sichtweise zum einen „Vermittlung zur Welt“, wir wenden uns durch das Medium Bewegung der Welt –dazu gehören Situationen, Personen, Dinge-, zu; zum anderen ist sie „Wahrnehmung der Welt“, wir erfahren, erleben und erkennen durch sie.
Hierbei liefert uns die Haut, unsere kinästhetischen Sinne, unser Orts- und Gleichgewichtssinn, unser Sehen und Hören viele Eindrücke, Informationen, Erfahrungen und auch Einsichten über unsere Umwelt und über uns selbst im Zusammenhang mit ihr.(4)
„Bewegung ist eine Art ‚Doppel-Medium‘, sie ist ein ‚Organ‘ der Erfahrung und ein ‚Instrument‘ der Gestaltung in einem; das heißt, sie ‚vermittelt‘ uns an unsere Mit- und Umwelt und diese umgekehrt an uns.“(5)
[...]
______
1 Vgl. Röthig, P. „Sportwissenschaftliches Lexikon“, Schorndorf 1977
2 Vgl. Brockhaus GmbH „dtv-Lexikon“, München 1999
3 Vgl. Größing, Stefan „Bewegungskultur und Bewegungserziehung“, Schorndorf 1993, S. 82
4 Vgl. Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.72,73
5 Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.72
Inhaltsverzeichnis
1. Bewegung
1.1 Grundsätzliches zur Bewegung
1.2 Bewegung als anthropologisch begründbares Grundbedürfnis von Kindern
2. Sensomotorik
2.1 Sinne und Wahrnehmung
2.2 Entwicklung und Bedeutung der Wahrnehmung
3. Humanistisches Menschenbild
3.1 Beschreibung des der Arbeit zugrunde liegenden Menschenbildes
4. Bedeutungsaspekte der Bewegung für die Entwicklung von Kindern
4.1 Entwicklungsbegriff
4.2 Entwicklung der Persönlichkeit
4.3 Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung
4.4 Entwicklung des Selbstkonzepts
4.5 Gesundheit und Wohlbefinden
4.5.1 Emotionales Empfinden
4.5.2 Der körperlich- gesundheitliche Aspekt
4.6 Kognitive Entwicklung
4.7 Soziale Entwicklung
5. Literaturverzeichnis
1. Bewegung
1.1 Grundsätzliches zur Bewegung
Das sportwissenschaftliche Lexikon definiert Bewegung als „Ortsveränderung eines Körpers oder einzelner seiner Teile im Verhältnis zur Zeit“ und erforscht vor allem die damit zusammenhängenden motorischen Bedingungen.[1]
Biologisch gesehen beruht aktive Bewegung auf „Energiefreisetzung durch den Stoffwechsel des Organismus“[2]
Wenn wir nun aber genauer hinsehen, stellen wir fest, dass die menschliche Bewegung nicht nur eine „Orts- und Lageveränderung“ ist, sondern sie immer auch ihren Sinn und ihre Beweggründe hat.
Hiermit nähern wir uns nun der phänomenologischen Sichtweise, die ganzheitliche Bewegungshandlungen im Sinnzusammenhang des Lebens eines Menschen beschreibt und erklärt. Die Erlebnisgehalte der Bewegung, ihre Ausdruckskraft und ihr dynamischer Ablauf werden bei dieser Betrachtung eine größere Bedeutung beigemessen, als die physikalische Raum-Zeit-Korrelation.[3]
Bewegung ist aus dieser Sichtweise zum einen „Vermittlung zur Welt“, wir wenden uns durch das Medium Bewegung der Welt –dazu gehören Situationen, Personen, Dinge-, zu; zum anderen ist sie „Wahrnehmung der Welt“, wir erfahren, erleben und erkennen durch sie. Hierbei liefert uns die Haut, unsere kinästhetischen Sinne, unser Orts- und Gleichgewichtssinn, unser Sehen und Hören viele Eindrücke, Informationen, Erfahrungen und auch Einsichten über unsere Umwelt und über uns selbst im Zusammenhang mit ihr.[4]
„Bewegung ist eine Art ‚Doppel-Medium‘, sie ist ein ‚Organ‘ der Erfahrung und ein ‚Instrument‘ der Gestaltung in einem; das heißt, sie ‚vermittelt‘ uns an unsere Mit- und Umwelt und diese umgekehrt an uns.“[5]
GRUPE weist darauf hin, dass Bewegung immer auch an kulturelle oder geschlechtsspezifische Werte geknüpft ist. MAUSS[6] schreibt hierzu, dass sich Bewegungen im weiteren Sinne, wie Eß- und Schlafgewohnheiten, Geburts- und Liebestechniken, Gang und Haltung, in erkennbarer Weise zwischen einzelnen Kulturen unterscheiden.
Dass die Bewegung nichts Konstantes ist, haben Untersuchungen über geschichtliche Veränderungen der Bewegungen, die u.a. von NITSCHKE[7] und EICHBERG[8] durchgeführt wurden, gezeigt.[9]
Wie einleitend bereits angesprochen, beinhaltet die Bewegung aus phänomenologischer Sichtweise, von der wir ausgehen, immer eine Bedeutung und Sinn.
OMMO GRUPE unterscheidet, von der Alltagswirklichkeit des Menschen ausgehend, vier unterschiedliche Bedeutungsdimensionen von Bewegung:
1. Die instrumentelle Bedeutung
Mit seiner Bewegung kann der Mensch etwas erreichen, herstellen, ausdrücken, darstellen und durchsetzen, aber auch erfahren, erproben und verändern. „Bewegung wird im Alltag, im Sport, im Arbeitsleben und im sozialen Umgang mit anderen funktional und instrumentell benutzt, als eine Art ‚Werkzeug‘, um etwas zu erreichen, durchzusetzen, herzustellen.“[10]
Die instrumentelle Bedeutung ist in einem gewissen Sinne für alle anderen Bewegungsbedeutungen grundlegend.
2. Die wahrnehmend –erfahrende Bedeutung (explorierend-erkundende Bedeutung)
Durch seine Bewegung erfährt der Mensch etwas über seine Körperlichkeit, über materiale Eigenschaften von Dingen und über Personen. Bewegung kann zu diesem Zweck bewußt instrumentell eingesetzt werden, der Erfahrungsgewinn kann aber auch eher beiläufig und zufällig erfolgen.
3. Die soziale Bedeutung
Die Bewegung ist in diesem Sinne ‚Vermittelndes Element‘ bei der Interaktion mit anderen . Für diese sozialen Beziehungen bietet in erster Linie unser leiblich-motorischer Apparat die Möglichkeit, in sozialen Situationen zu handeln, mit anderen Menschen umzugehen, Verbindungen zu ihnen aufzunehmen, aufrechtzuerhalten oder sie auch abzubrechen. Solche sozialen Bedeutungen der Bewegung besitzt man nicht so einfach, man muss sie lernen und man erwirbt sie durch die Bewegung.
4. Die personale Bedeutung
In seiner Bewegung und durch sie erlebt und erfährt sich der Mensch selbst, er kann sich entsprechend verändern und verwirklichen. Sie trägt dazu bei, sich selbst immer besser kennenzulernen.[11]
GRUPE macht darauf aufmerksam, dass im Auge zu behalten sei, wie sehr diese Bedeutungen, oder auch „Funktionen“, zusammenhängen, miteinander verschmelzen, aber auch unterschiedliche Akzente darstellen können.[12]
Abschließend zu dieser kleinen, grundsätzlichen Darstellung von Bewegung möchte ich zu der Frage „was ist Bewegung“ Überlegungen von der Kinderbuchautorin CHRISTINE MERZ anführen, die diese Frage im Bezug auf deren Bedeutung für Kinder beschreibt.
Sie nähert sich dem Thema an, indem sie verdeutlicht, dass Bewegung sehr viel mit Beweglichkeit, mit beweglich-sein zu tun hat. „Und dies eigentlich im Hinblick auf ‚Fortbewegung‘- AUF SICH HINBEWEGEN ZU EINEM ZIEL. Zielgerichtetes Fortbewegen. Groß werden wollen, etwas können, Dinge beherrschen, dazulernen...
.Bewegtheit und Bewegung sind dynamische Angelegenheiten, die Phantasie und Kreativität im Umgang mit ihnen verlangen. Nicht umsonst ist Un-Beweglichkeit,
ist Starrheit,
eine der großen Gefahren-
im körperlichen wie im seelischen Bereich.“[13]
Ferner schreibt sie, dass Körper, Geist und Seele aneinander gebunden sind. „Wer die Seele pflegt – tut etwas für seinen Körper, wer seinem Körper Gutes tut – pflegt seine Seele.“[14]
Dies ist eine schöne Überleitung zu unserem zweiten Punkt „Bewegung als anthropologisch begründbares Grundbedürfnis von Kindern“, bei dem das Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele als wichtige anthropologische Auffassung gilt. (Siehe „Leiberfahrung als ganzheitliche, unmittelbare und existentielle Erfahrung“, S.8).
Nicht zu vergessen, gerade im Bezug auf Kinder, ist, dass Bewegung Ausdruck ihrer LEBENSFREUDE –zugleich aber auch ein wichtiges Mittel zur Förderung ihrer Entwicklung ist. Gelernt und Erfahren wird im frühen Kindesalter in erster Linie über Wahrnehmung und Bewegung. Diese unbestrittene Erkenntnis werden wir in den folgenden Kapiteln fundierter darlegen.
1.2 Bewegung als anthropologisch begründbares Grundbedürfnis von Kindern
In diesem einleitenden Kapitel unserer Seminararbeit möchte ich versuchen, den anthropologischen Hintergrund unseres Themas deutlich zu machen. Dies bedeutet, konkret vom Menschen auszugehen, von seiner Beziehung zu seinem Körper, seinem Verhältnis zu seiner Welt und Umwelt. Hierbei spielt jedoch nicht nur das Individuum allein eine Rolle, sondern es muss mit sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren verknüpft werden. Individuelles und Soziales verbinden sich jeweils.
Auf die Frage, warum sich die Sportpädagogik mit anthropologischen Fragestellungen befasst, schreibt GRUPE: „Ein wichtiger Grund für die Beschäftigung mit anthropologischen Fragen liegt darin, dass wohl allen grundlegenden pädagogischen Entscheidungen, Handlungen und Maßnahmen –mehr oder weniger deutlich- Vorentscheidungen anthropologischer Art zugrundeliegen, bzw. dass sie auf einer bestimmten Sicht auf den Menschen beruhen.“[15]
Für BOLLNOW[16] stellt die Anthropologie auch ein „Schlüssel“ zum Vorverständnis von pädagogischen Systemen dar.
Als anthropologische Vorentscheidungen können beispielsweise Annahmen über die „Freiheit“ des Menschen als Person im Sinne von Wahl-, Entscheidungs-, und Willensfreiheit gezählt werden, sowie das Verhältnis des Individuums zu Gemeinschaft, Kultur und Gesellschaft, aber auch über das Angewiesensein des Kindes auf Hilfe und Beistand.
Eine der tragenden Grundannahmen anthropologischer Betrachtungsweise ist die Möglichkeit des Menschen zu freiem Handeln und verantwortlichem Entscheiden.
So sind die Erziehungsideen vieler Pädagogen und auch ganzer pädagogischer Systeme in bezug auf Wert, Notwendigkeit und Bedeutungseinschätzung der Leibeserziehung von solchen Grundannahmen über den Menschen bestimmt.[17]
Alle vorhandenen Bewegungslehren haben ein Menschenbild zur Grundlage, von dem sie in ihrer bewegungstheoretischen Annahmen ausgehen. So betrachtet die Biomechanik den Menschen als mechanischen Körper, dessen Aktionen und Möglichkeiten vor allem unter dem Blickwinkel der traditionellen Physik betrachtet werden und verstehbar erscheinen. Das kybernetische Modell der Sensomotorik betrachtet den Menschen vor allem unter dem Aspekt seiner Steuerungsfunktionen. Untersucht werden hier die Bewegungsreize, die ein bestimmtes Bewegungsergebnis provozieren.[18]
Doch trotz der Fülle von Einzelerkentnissen und Detailergebnissen der menschlichen Forschung sollten diese auf den Mensch als Ganzen bezogen werden.
So äußert sich MOEGLING in seinem Text „Ganzheitliche Bewegungserziehung“ hierzu folgendermaßen: „Grundsätzlich ist zu sagen: Allein für sich genommen ist das zugrundegelegte Menschenbild eines spezialisierten Bewegungslehreansatzes zu eng und zu wenig aussagekräftig.
‚Ein ganzheitlicher Erkenntnisansatz versucht den Menschen in seiner Verwobenheit von psychischen, gesellschaftlich-kulturellen, ökologischen und motorischen Bezügen zu verstehen, den Menschen als Leibsubjekt mit sozialökologischen Bezügen‘(PETZOLD / BERGER 1983, 452)“[19]
Somit ist das ganzheitliche Menschenbild einer integrativen Bewegungslehre die Voraussetzung dafür, unterschiedliche Zugangsweisen zur Bewegung verstehen zu können.
In unserer Arbeit gehen wir vom humanistischen Menschenbild aus, auf das wir im 3. Kapitel näher eingehen werden. Dieses Menschenbild deckt sich mit den vorangestellten anthropologischen Annahmen über den Menschen und sieht ihn ebenfalls als Ganzheit. Psychische, emotionale, soziale, kognitive und somatische Prozesse sind aufeinander bezogen. An jeder Handlung ist immer der ganze Mensch beteiligt; Leib und Seele, Vernunft und Gefühl werden als Einheit betrachtet. Aus humanistischer Sicht ist der Mensch ein handelndes Subjekt, ein psychisches, biologisches und soziales Wesen[20]
Laut philosophisch-orientierten Anthropologen ist der Mensch ein körperlich, bewegliches, sinnsuchendes und kulturell geformtes Lebewesen. Bewegung und Körperlichkeit sind demnach wesentliche Merkmale des Menschseins. Ohne Bewegung ist menschliches Leben nicht vorstellbar. Darüber hinaus ist sie ein unverzichtbares Element in der Menschwerdung.
Die Bewegungsentwicklung beginnt bereits im Mutterleib, vollzieht sich über die gesamte Entwicklung des Menschen und erst der Tod setzt jeglicher körperlichen Bewegung ein Ende.
Unter Bewegung ist keineswegs nur die sportliche Betätigung zu verstehen, auch die „innere Bewegung“ spielt eine wesentliche Rolle. Innere Bewegungen können zum einen Gefühle sein („wir sind bewegt“), aber auch organische Prozesse, wie unser Herzschlag, der Blutkreislauf, oder unsere Lungen, die atmen.
STEFAN GRÖßING schreibt in seinem Text „Bewegungskultur und Bewegungserziehung“, dass es als sehr wahrscheinliche anthropologische Annahme gelten darf, dass der Mensch mit einem Bewegungstrieb ausgestattet ist.
„Der angeborene und im Laufe des Lebens schwächer werdende Bewegungstrieb sucht die Spannungsverminderung und Befriedigung in der Bewegung und dies um so häufiger und konsequenter, je stärker er vorhanden ist. Deshalb bewegen sich Kinder mehr als Jugendliche und diese immer noch häufiger als Erwachsene. Alte Menschen sind die motorisch ruhigsten, wenn ihnen die tägliche Bewegung nicht zur Gewohnheit oder beruflichen Notwendigkeit geworden ist.“[21]
Die Dauer und das hohe Ausmaß körperlicher Anstrengung der Bewegungshandlungen von Kindern beim Spielen und Toben, ließe so manchen Erwachsenen, der sich hierbei beteiligt, nach kurzer Zeit erschöpft aufgeben, da sich Kleinkinder etwa dreimal soviel bewegen, wie Erwachsene.
Auch Dirk Scheel greift den, in der Literatur, die sich mit der kindlichen Bewegung befaßt, bekannten Begriff des „Bewegungsdranges“ auf. Dieser wird als ein genetisch bedingtes Antriebspotential, welches allen Kindern, vorausgesetzt, sie durchlaufen eine normale vorgeburtliche Entwicklung, mitgegeben ist, begriffen. Durch den Überschuss hirnphysiologischer Reize auf die Muskeln werden Bewegungsreaktionen ausgelöst.
Laut des Kinderarztes Theodor Hellbrügge ist der kindliche Bewegungsdrang, der sich auch darin äußert, dass Kinder außerstande sind, selbst im Schlaf oder Ruhezustand ihre Glieder unbewegt zu lassen, eine „Naturnotwendigkeit“ , um den Wachstumsstoffwechsel zu befriedigen. Daher ist es verständlich, dass der Bewegungsdrang um so stärker ausgeprägt ist, je jünger das Kind ist. Sobald dann das Wachstum nachläßt, was mit dem Beginn der Pubertät der Fall ist, hört auch der kindliche Bewegungsdrang auf.[22]
Dirk Scheel legt in seinen Ausführungen „Kinder brauchen Bewegung“ einen äußerst wichtigen Aspekt der Dringlichkeit von Bewegung für die kindliche Entwicklung dar: Die genetisch bedingte „Energie“, die das Kind ständig zur Bewegung drängt, reagiert außerordentlich umweltabhängig.(!)
Diese Abhängigkeit tritt weniger in Erscheinung, wenn Kinder ihrem Bewegungstrieb durch die Offenheit ihrer Umwelt freien Lauf lassen können.
„Eine Behinderung in der Abreaktion des Bewegungsdranges infolge von Umwelteinflüssen wie Verboten, Ängsten der Eltern und räumlichen Unzulänglichkeiten führt zu einem Agressionsstau, der sich gegen das Kind wendet und seine Ich-Bildung verhindert. Die vorhandene ‚Energie‘ kommt nicht zur Geltung und kann nicht die für die Bewegungsentwicklung notwendigen Impulse geben. Bei lang anhaltender Unterdrückung des Bewegungsbedürfnisses des Kindes ‚erlischt‘ schließlich die ‚Energie‘, und das Kind erscheint in seiner Umwelt als bewegungsängstlich, ungeschickt, träge, unbeweglich und bewegungsvermeidend.“[23]
Nach einer Untersuchung von R.A. Spitz, traten bei Kindern, aufgrund mangelnder Bewegung und Fürsorge z.T. nicht wiedergutzumachende Schäden in ihren körperlichen, intellektuellen und sozialen Fähigkeiten auf.[24]
Wenn wir Kinder in unserer Umgebung beobachten, können wir diese natürlich vorhandene „Energie“, die sie umgibt, förmlich spüren /sehen. Wo immer man Kinder beobachten kann, sind sie stets unterwegs, möchten alles, was sie wahrnehmen können, erreichen, erkunden, probieren und benutzen.
Aus anthropologischer Sicht bieten Bewegungshandlungen dem Menschen eine reichhaltige Palette bildender Erfahrungen und prägender Erlebnisse. Hierbei ist die Umwelt der natürliche Lehrmeister des Kindes. „Jeder Hügel fordert zum Ersteigen, jeder Baum zum Klettern auf. Jede Mauer reizt zum Darüberbalancieren, jeder Graben zum Darüberspringen. Jede Stange lockt zum Turnen, jedes Fahrzeug zum Ziehen, Schieben und Fahren“[25]
Der Körper und die Bewegung nehmen demnach für Kinder in einem ganzheitlichen Sinne eine entscheidende Rolle in ihrer Entwicklung und Reifung, bei der Erfahrung von Dingen, Personen und Umwelt, bei ihrer Selbsterfahrung, dem Aufbau ihrer sozialen Beziehungen und damit letztendlich bei dem Aufbau ihrer Handlungsfähigkeit ein.[26]
Auf die Bedeutungsaspekte der Bewegung für die Entwicklung von Kindern werden wir im 4. Abschnitt unserer Arbeit näher eingehen. Hierbei konzentrieren wir uns in erster Linie auf die Entwicklung des Selbstkonzepts, Gesundheit und Wohlbefinden, die soziale und kognitive Entwicklung.
Die Sinnes- und Sinnlichkeitserfahrungen im Bezug auf die Bewegungsentwicklung erörtern wir im 2. Kapitel ausführlich.
OMMO GRUPE hebt aus anthropologischen Einsichten im Bezug auf Körper und Bewegung fünf Gesichtspunkte hervor[27]:
Leiberfahrung als ganzheitliche, unmittelbare und existentielle Erfahrung
Der Leib, der Körper, Seele und Geist vereint, wird als Ganzheit gesehen. Die biologischen und geistig-seelischen Kräfte, die sich mehr oder weniger unverbunden gegenüberstehen, sind ineinander verschränkt, durchdringen sich. Das Kind sollte sich entsprechend als unmittelbar Ganzes erleben. Dadurch wird Leiblichkeit für das Kind zu etwas Existentiellem, sie wird in den dynamischen Verlauf seiner Entwicklung einbezogen, dann sogar geradezu zur Grundlage dieser Entwicklung.
JEAN JAQUES ROUSSEAU (1712-1778): „Vor allem der Seele wegen ist es nötig, den Körper zu üben.“[28]
Leiberfahrung als Welterfahrung
Leiberfahrungen bedeuten für das Kind über die unmittelbare existentielle Eigenerfahrung hinaus, auch immer Welterfahrung und damit Welterschließung. Der Körper des Kindes ist Mittler und Vermittler zwischen sich und der Umwelt.
Einen wesentlichen Teil dieser Welterfahrung nehmen die sozialen Beziehungen ein. Durch körperliche Voraussetzungen erhalten Kinder die Möglichkeit, soziale Verbindungen aufzubauen. Der Körper ist hierbei Ausdrucksorgan und Medium für die Vermittlung seiner selbst zur Welt, zu Menschen, zu Aufgaben und Situationen.
Zwischen Übereinstimmung und Trennung – die kindliche Ich-Entwicklung
Das leibliche Erleben des Kindes ist intensiver, stärker an seine Leiblichkeit gebunden, als beim Erwachsenen. In allen Bewegungsaktivitäten gewinnt es Erlebnisse, in denen es sich selbst erlebt. Die leiblichen Äußerungen sind bei Kindern oft ungehemmter, elementarer, scheinbar unkontrollierter, als bei Erwachsenen. Auch die geringere emotionale Distanz, seiner Umwelt gegenüber ist zu beobachten. Sie äußert sich beispielsweise darin, dass es sich vor dem Hexenhäuschen richtig fürchtet; es schwitzt und zittert, wenn Angstgefühle in ihm aufsteigen.
Wir beobachten bei Kindern in ihrer Bewegung und ihrem Ausdruck immer den ganzen kleinen Menschen.
Es gibt keine Trennung zwischen Körper und Gebärde, Stimme und Seele. Alle leiblichen Funktionen des Kindes, die unsichtbaren inneren sowie die von außen seh- und hörbaren, sind Ausdruck seelischen Lebens. Aus allen spricht ‚der ganze kleine Mensch‘[29] „Erst mit zunehmendem Abstand von den Dingen und auch von sich – und das heißt mit zunehmender Differenzierung seines Ichs – wächst der ‚Abstand‘ von der eigenen Leiblichkeit beziehungsweise umgekehrt: Mit dem möglichen Abstand von der eigenen Leiblichkeit wächst auch die mögliche Distanz zu sich selbst und zur Welt.“[30]
Der Körper – Mittel des Großwerdens: Ich-Entwicklung und Körper-Objektivierung
An seinen körperlichen Fähigkeiten kann das Kind seine Fortschritte, die auch Mittel und Symbol seines Größerwerdens sind, ablesen. Über seinen Körper erlebt das Kind sowohl seine Grenzen, als auch seine Erfolge. Dem entsprechend hat das Leibliche für das Selbständigwerden und die „Ich-Findung“ des Kindes eine zentrale Bedeutung. Während für das Neugeborene sein Leib noch weitgehend „seine Welt“ darstellt, wird er im Verlaufe der kindlichen Entwicklung immer mehr zum „Werkzeug“ für die Auseinandersetzung und Gestaltung der Umwelt.[31] Ein wichtiger Entwicklungsschritt hierbei ist die „Objektivierung des eigenen Körpers“. Dies bedeutet, dass in dem Moment, in dem das Kind seinen Leib als seinen Leib erlebt, es ihn einerseits als etwas ihm identisches erfährt, zugleich jedoch auch als etwas ihm Gegenüberstehendes, instrumentell Verfügbares. Dieses veränderte Bewußtsein seines Leibes zeigt sich auch in Veränderungen seines Selbst- und Weltverhältnisses.
Bewegung als besonderer Ausdruck kindlicher Leiblichkeit
Über sein Bewegungsverhalten wird das Kind sozialisiert. Bewegung ist in diesem Sinne für das Kind Erfahrungsorgan und Gestaltungsinstrument in einem. „Über seine Bewegung erfaßt das Kind seine Welt, und jede neue Bewegung vermittelt ihm über neue und größere Bewegungsräume zugleich größere Erfahrungsräume, die alte Vertrautheiten und neue Aufforderungen verbinden. Sein Greifen ist auch ein Be-Greifen, sein Fassen ein Er-Fassen, also Teil der Entwicklung von Wissen, Urteil und Einsicht.“[32]
Auch die Entwicklungstheorie Piagets bezieht sich auf diese Vorstellung.
Wirklichkeitserfahrung als ein kindliches Entwicklungsthema
Der Entwicklungspsychologe und Pädagoge Alfred Petzelt[33] nennt Kinder aus entwicklungspsychologischer Sicht „Wirklichkeitssucher“. Ihre Bewegung und ihre Körperlichkeit sind ein entscheidendes Mittel und wichtige Voraussetzung dafür, dass Kinder zu kleinen Entdeckern werden können.
„Der Aufbau körperlicher Identität, eines Bewegungs- und Körperbildes, die für das Kind eine wichtige Entwicklungsaufgabe darstellen, stellt sich zugleich als ein wesentlicher Teil seiner Persönlichkeitsbildung dar.“[34]
Gedanken über die Bedeutung von Körper- und Bewegungserfahrungen für die kindliche Entwicklung sind durchaus nicht neu. Um dies zu untermauern, möchte ich an dieser Stelle einige namhafte Pädagogen der Vergangenheit zitieren:
„PESTALOZZI (1807) ging davon aus, dass Körperbildung vorbehaltlos und gleichwertig in die Gesamterziehung zu integrieren sei. In seiner Elementargymnastik betonte er, dass die Natur ‚das Kind als untrennbares Ganzes gibt‘ mit vielseitigen Anlagen des Herzens, des Geistes und des Körpers, deren Entwicklung ‚unzertrennlich miteinander verbunden‘ ist.“[35]
Er verstand den Mensch als ganzheitliches Wesen, Kopf, Hand und Herz gehören entsprechend zusammen, der Leib ist das ‚Werkzeug‘ der Seele.
Dieses Phänomen Ganzheit ist auch ein wichtiges Merkmal der Gestaltkreistheorie von WEIZSÄCKERS: Optische, akustische und kinästhetische Wahrnehmung und Bewegung bilden eine biologische Einheit, mit Hilfe dieser sich das Kind seine Welt erobert. Das ganzheitliche Auffassen ist eine anthropologische Grunddimension des Menschen.
Auch BUYTENDIJK[36] betont die enge Verbindung von Körper, Bewegung und Umwelt.
Die Idee der Erfassung des Menschen in seiner Ganzheit über Bewegung wurde seit der Jahrhundertwende von GUILMAIN in Frankreich aufgegriffen und von KIPHARD seit ca. 1955 in der Bundesrepublik systematisch voran getrieben.[37]
„Die sogenannte ‚psychomotorishe Erziehungsmethode‘ legt den Schwerpunkt auf das Bewegungserleben des Kindes. Die Kenntnis von den Bewegungszusammenhägen im eigenen Körper und der Umgang mit vielseitigem Material verbessern nicht nur die motorischen Fähigkeiten, sondern beeinflussen positiv den allgemeinen Lern- und Leistungsprozeß (VAYER 1975; DECKER 1976, 1980, 1982; EGGERT/KIPHARD 1976; KIPHARD 1979; SCHLLING 1976; MERTENS 1981).“[38]
„Für ROUSSEAU (1712-1778), der seine Pädagogik auf der Grundlage einer Anthropologie entwickelt, die den Menschen als Naturwesen begreift, das dann gut und glücklich ist, wenn es seinen naturhaften Bedürfnissen folgt, während der Abfall von der Natur es unglücklich macht, gehört der Körper zu den entscheidenden Grundlagen menschlichen Lebens.[39] “
„Die PHILANTROPEN, die viele der Gedankengänge ROUSSEAUS übernahmen, betonten ebenfalls die tragende Rolle des Körperlichen im Zusammenhang menschlichen Lebens...“[40]
„Auch für JAHN (1816) ist der Leib ein wichtiger Teil des Menschen; ihm geht es um ‚Gleichgewicht‘ und ‚Gleichmäßigkeit‘ in der Beziehung von Leib und Seele.“[41]
Auch in reformpädagogischen Konzepten finden wir immer wieder Gedanken der Verschmelzung von „Körperbildung“ und der Gesamterziehung.
MARIA MONTESSORI schreibt: „Von gleich großer Bedeutung für die Entwicklung des Kindes ist seine eigene spontane Bewegung. Das Kind muss sich immer bewegen...“[42]
BRUNO BETTELHEIM, Professor für Psychologie, Pädagogik und Psychiatrie, erklärt:
„Man ist sich darüber einig, dass das Kind die Welt nur aktiv bemeistern, erkennen und verstehen kann, indem es die Fähigkeit entwickelt, sich...zielstrebig zu bewegen.“[43]
RENATE ZIMMER stellt in ihrem „Handbuch der Bewegungserziehung“ eine weitere Analyse und Zusammenfassung der vielfältigen Funktionen, die Bewegung vor allem für die Entwicklung von Kindern haben kann, vor. Nachdem wir uns dieser Thematik anfangs aus anthropologischer Sicht genähert haben, darf bei dem Thema unserer Arbeit folgende Differenzierung, die von der kindlichen Entwicklung ausgeht, nicht fehlen.
Beim Lesen dieser Darstellung werden Sie jedoch feststellen, dass sich viele Aspekte mit den eingangs von OMMO GRUPE vorgestellten „unterschiedlichen Bedeutungsdimensionen der Bewegung“ decken.
„Funktionen der Bewegung für die Entwicklung von Kindern
personale Funktion: Den eigenen Körper und damit sich selber kennenlernen; sich mit den körperlichen Fähigkeiten auseinandersetzen und ein Bild von sich selbst entwickeln.
Soziale Funktion: Mit anderen gemeinsam etwas tun, mit- und gegeneinander spielen, sich mit anderen absprechen, nachgeben und sich durchsetzen.
Produktive Funktion: Selber etwas machen, herstellen, mit dem eigenen Körper etwas hervorbringen (z.B. eine sportliche Fertigkeit wie einen Handstand oder einen Tanz).
Expressive Funktion: Gefühle und Empfindungen in Bewegung ausdrücken, körperlich ausleben und ggf. verarbeiten.
Impressive Funktion: Gefühle wie Lust, Freude, Erschöpfung und Energie empfinden, in Bewegung erfahren.
Explorative Funktion: Die dingliche und räumliche Umwelt kennenlernen und sich erschließen, sich mit Objekten und Geräten auseinandersetzen und ihre Eigenschaften erfassen, sich den Umweltanforderungen anpassen bzw. sie sich passend machen.
Komparative Funktion: Sich mit anderen vergleichen, sich miteinander messen, wetteifern und dabei sowohl Siege verarbeiten als auch Niederlagen ertragen lernen.
Adaptive Funktion: Belastungen ertragen, die körperlichen Grenzen kennenlernen und die Leistungsfähigkeit steigern, sich selbstgesetzten und von außen gestellten Anforderungen anpassen.“[44]
Im nächsten Abschnitt unserer Arbeit wird Gerlinde Tom auf die Entwicklung und Bedeutung der Wahrnehmung eingehen, nach dem ich mich dann mit dem Menschenbild, das wir zugrunde legen, befasse.
Den Schwerpunkt bildet das Kapitel „Bedeutungsaspekte der Bewegung für die Entwicklung von Kindern“, welches auch gleichsam den Abschluss der Seminararbeit darstellt.
2. Sensomotorik
2.1 Sinne und Wahrnehmung
„Motorische Entwicklung und Entwicklung der Wahrnehmung stehen in engem Zusammenhang – um so mehr je jünger ein Kind ist. Motorik als willkürliche Bewegung ist ohne Wahrnehmung nicht vorstellbar. Der enge Zusammenhang zwischen Wahrnehmung bzw. Sensibilität und Motorik wird deutlich in dem Begriff ‚Sensomotorik‘.“[45]
„Sinnliche Erfahrungen stellen die Grundlage kindlichen Handelns dar; sie sind wesentliche Erkenntnisquellen zur Aufnahme und Verarbeitung von Umwelteindrücken. Über Wahrnehmung und Bewegung erschliessen sich Kinder den Zugang zur Welt. Sie sind die Wurzel aller Erfahrungen, durch die sie die Welt für sich jeweils neu wieder aufbauen und verstehen können (Zimmer 1989, 98).“[46] In der heutigen Zeit werden die Sinne der Kinder nicht mehr ausreichend gefördert. Kinder kommen heute mit anderen Alltagserfahrungen in die Schule. Fernseher, Computer- und Videospiele, Stereoanlagen sowie Walkman, die einen herausgehobenen Stellenwert bekommen haben, belasten Auge und Ohr sehr stark. Industriell angefertigtes Essen, Tiefkühlkost und Fast Food ist geschmacklich genormt, so dass kaum geschmackliche Nuancen ausgemacht werden können und man fast nur noch Geschmacksverstärker auf der Zunge spürt. Zuneigung und Liebe verbunden mit Berührungen, wie Streicheln oder Kuscheln werden in einer Gesellschaft, in der beide Elternteile berufstätig sind, immer seltener. Autoabgase, andere Umweltverunreinigungen sowie das Großstadtleben lassen kaum Spielraum für einen ausgeprägten Geruchssinn. Die Sinne werden also kaum noch beansprucht, gefordert und somit so gut wie gar nicht mehr gefördert. Kinder zeigen in der Schule vermehrt Verhaltensweisen, die mit Begriffen wie Lese-Rechtschreibschwäche, Dyskalkulie, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen, Koordinationsschwäche, geringe Frustrationstoleranz beschrieben werden. Möglichkeiten des Lernens mit allen Sinnen, d.h. durch bewegen, riechen, schmecken, sehen, tasten und fühlen werden immer geringer. Dabei sind Erfahrungen mit dem eigenen Körper wichtige Grundlage für das Erlernen von schreiben, lesen, rechnen und der Kontaktaufnahme mit anderen Menschen. Das Lernen mit Kopf, Herz und Hand, d.h. ganzheitliches Lernen ist in dieser Situation der „veränderten Kindheit“ von großer Bedeutung.[47]
Das Zusammenspiel der einzelnen Sinne ist für das Verständnis der Umwelt von besonderer Wichtigkeit. In einer Welt, in der Entwicklung und Erziehung des Kindes so vernachlässigt werden, ist die Schule gefordert und sollte daher die Sinneswahrnehmung der Schüler ansprechen. Beim Lernen mit allen Sinnen geschieht einerseits diese Förderung, andererseits wird die Verständnisfähigkeit des Schülers bei einem bestimmten Sachverhalt angesprochen du ihm so ein Konzept gegeben, diesen Sachverhalt besser zu verinnerlichen. Lernen mit allen Sinnen erfüllt somit mehrere Aufgaben und sollte deshalb für den Unterricht genutzt werden, wobei es meiner Ansicht nach nicht nur und bei jedem Sachverhalt zur Anwendung kommen sollte, sondern zu einem gesunden Zusammenspiel mehrerer Unterrichtsmethoden.[48]
[...]
[1] Vgl. Röthig, P. „Sportwissenschaftliches Lexikon“, Schorndorf 1977
[2] Vgl. Brockhaus GmbH „dtv-Lexikon“, München 1999
[3] Vgl. Größing, Stefan „Bewegungskultur und Bewegungserziehung“, Schorndorf 1993, S. 82
[4] Vgl. Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.72,73
[5] Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.72
[6] Mauss, M. „Die Techniken des Körpers“. In: König, R./Schmalfuss, A. „Kulturanthropologie“, Düsseldorf 1972, 91-108
[7] Vgl. Nitschke, A. „Sport, Körpererfahrung und Formen der Gesellschaft“ In: Sportpädagogk 4 (1980), 11-12
[8] Vgl. Eichberg, H. „Leistung, Spannung, Geschwindigkeit. Sport und Tanz im gesellschaftlichen Wandel des 18./19. Jahrhunderts. Stuttgart 1978
[9] Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.75
[10] Zimmer, Renate „Handbuch der Bewegungserziehung“, Freiburg im Breisgau 1993, S.14
[11] Vgl. Zimmer, Renate „Handbuch der Bewegungserziehung“, Freiburg im Breisgau 1999, S.14 und Vgl. Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.84
[12] Vgl. Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.84
[13] Merz, Christine „Was Kinder bewegt“. In: Zimmer, R./Cicus „Kinder brauchen Bewegung – brauchen Kinder Sport?“, Aachen 1992, S.12,18
[14] Merz, Christine „Was Kinder bewegt“. In: Zimmer, R./Cicus „Kinder brauchen Bewegung – brauchen Kinder Sport?“, Aachen 1992, S.20
[15] Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.13
[16] Vgl. Bollnow, O.F.: „Die Pädagogik der deutschen Romantik“, Stuttgart 1967, S. 25
[17] Vgl. Grupe, Ommo, 1982, S. 13,14
[18] Vgl. Moegling, Klaus: „Ganzheitliche Bewegungserziehung“, Immenhausen1999, S.42
[19] Moegling, Klaus, Immenhausen 1999, S. 43
[20] Vgl. Zimmer, Renate: „Handbuch der Psychomotorik“, Freiburg 1999, S.27
[21] Größing, Stefan „Bewegungskultur und Bewegungserziehung“, Schorndorf 1993, S.83
[22] Vgl. Hellbrügge, Theodor: „Biologische Grundlagen zur Bewegungserziehung und zum Kindersport“.In: Zimmer/Cicurs: „Kinder brauchen Bewegung. Brauchen Kinder Sport?“, Aachen 1992, S.188ff.
[23] Scheel, Dirk „Kinder brauchen Bewegung“, München 1978, S. 10
[24] Vgl. Scheel, Dirk, 1978, S. 10
[25] Kiphard, E.J. „Wie weit ist ein Kind entwickelt?“, Dortmund 1976
[26] Vgl. Grupe, Ommo „Zur Bedeutung von Körper-, Bewegungs- und Spiel- Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. In: Altenberger, H./ Maurer, F.„Kindliche Welterfahrung in Spiel und Bewegung“, 1992, S.11
[27] Vgl. Grupe, Ommo „Zur Bedeutung von Körper-, Bewegungs- und Spiel- Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. In: Altenberger, H./ Maurer, F.„Kindliche Welterfahrung in Spiel und Bewegung“, 1992, S.11ff.
[28] Unfallkasse Hessen: „Mehr Sicherheit im Schulsport“, Karlsruhe, S.7
[29] Vgl. Jacobs, Dore „Bewegungsbildung/Menschenbildung“, Wolfenbüttel 1985, S. 15
[30] Vgl. Grupe, Ommo „Zur Bedeutung von Körper-, Bewegungs- und Spiel- Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. In: Altenberger, H./ Maurer, F.„Kindliche Welterfahrung in Spiel und Bewegung“, 1992, S.14
[31] Siehe hierzu auch: Bittner, Günther „Erscheinungsleib, Werkzeugleib, Sinnenleib“
[32] Vgl. Grupe, Ommo „Zur Bedeutung von Körper-, Bewegungs- und Spiel- Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. In: Altenberger, H./ Maurer, F.„Kindliche Welterfahrung in Spiel und Bewegung“, 1992, S.17
[33] Vgl. Petzelt, Alfred „Kindheit-Jugend-Reifezeit. Grundriß der Phasen psychischer Entwicklung“, Freiburg 1962, 132 ff.
[34] Vgl. Grupe, Ommo „Zur Bedeutung von Körper-, Bewegungs- und Spiel- Erfahrungen für die kindliche Entwicklung. In: Altenberger, H./ Maurer, F.„Kindliche Welterfahrung in Spiel und Bewegung“, 1992, S.18
[35] zitiert nach Müller, Christina „Bewegte Grundschule“, Sankt Augustin 1993, S. 16
[36] Siehe auch Buytendijk, Frederik J.j. „Das Menschliche – Wege zu seinem Verständnis. Stuttgart, 1958
[37] Vgl. Mertens, Krista „Lernprogramm zur Wahrnehmungsförderung, Gießen 1983, S.9
[38] Mertens, Krista „Lernprogramm zur Wahrnehmungsförderung, Gießen 1983, S.9
[39] zitiert nach Grupe, Ommo: „Bewegung, Spiel und Leistung im Sport. Grundthemen der Sportanthropologie, Schorndorf 1982, S.33
[40] zitiert nach Grupe, Ommo: a.a.O. 1982, S.33
[41] zitiert nach Grupe, Ommo: a.a.O. 1982, S.34
[42] Montessori, Maria „Grundlagen meiner Pädagogik. In: Oswald/Schulz-Benesch „Grundgedanken der Montessori-Pädagogik. 2. Aufl., Freiburg 1971. Zitiert nach Müller, Christina „Bewegte Grundschule“, Sankt Augustin 1993, S. 16
[43] Bettelheim, Bruno „Liebe allein genügt nicht“, Stuttgart 1970.Zitiert nach Bärwinkel, A. u.a. „Bewegungsspiele mit Kindern“, Weinheim 1994, S.13
[44] Zimmer, Renate „Handbuch der Bewegungserziehung“, Freiburg im Breisgau 1999
[45] Dordel, Sigrid: Bewegungsförderung in der Schule, Verlag modernes Lernen, Borgmann KG, Dortmund:
1987, S. 120
[46] Bewegte Kindheit: Kongressbericht; Osnabrück, 29.2.-2.3. 1996; Hrsg. von Renate Zimmer; Schorndorf: Hofmann, 1997
[47] Vgl. Renate Zimmer: Veränderte Kindheit – veränderte Schule. In: Niedersächsisches Kultusministerium, Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Niedersachsen (Hrsg.): Bewegte Schule, Ringordner 1999, S. 3ff
[48] Vgl. Renate Zimmer: Die Sinnesschule – Psychomotorisch orientierte Bewegungserziehung. In: Sportpädagogik – Sammelband: Bewegte Schule, Friedrich Verlag. Seelze 2000, S. 104f