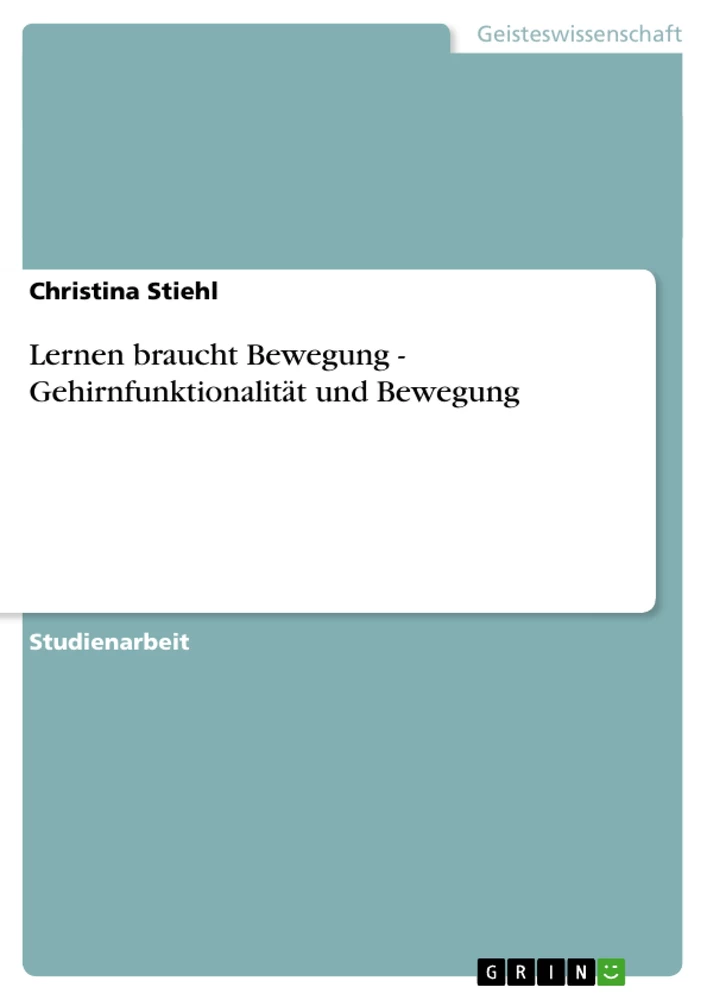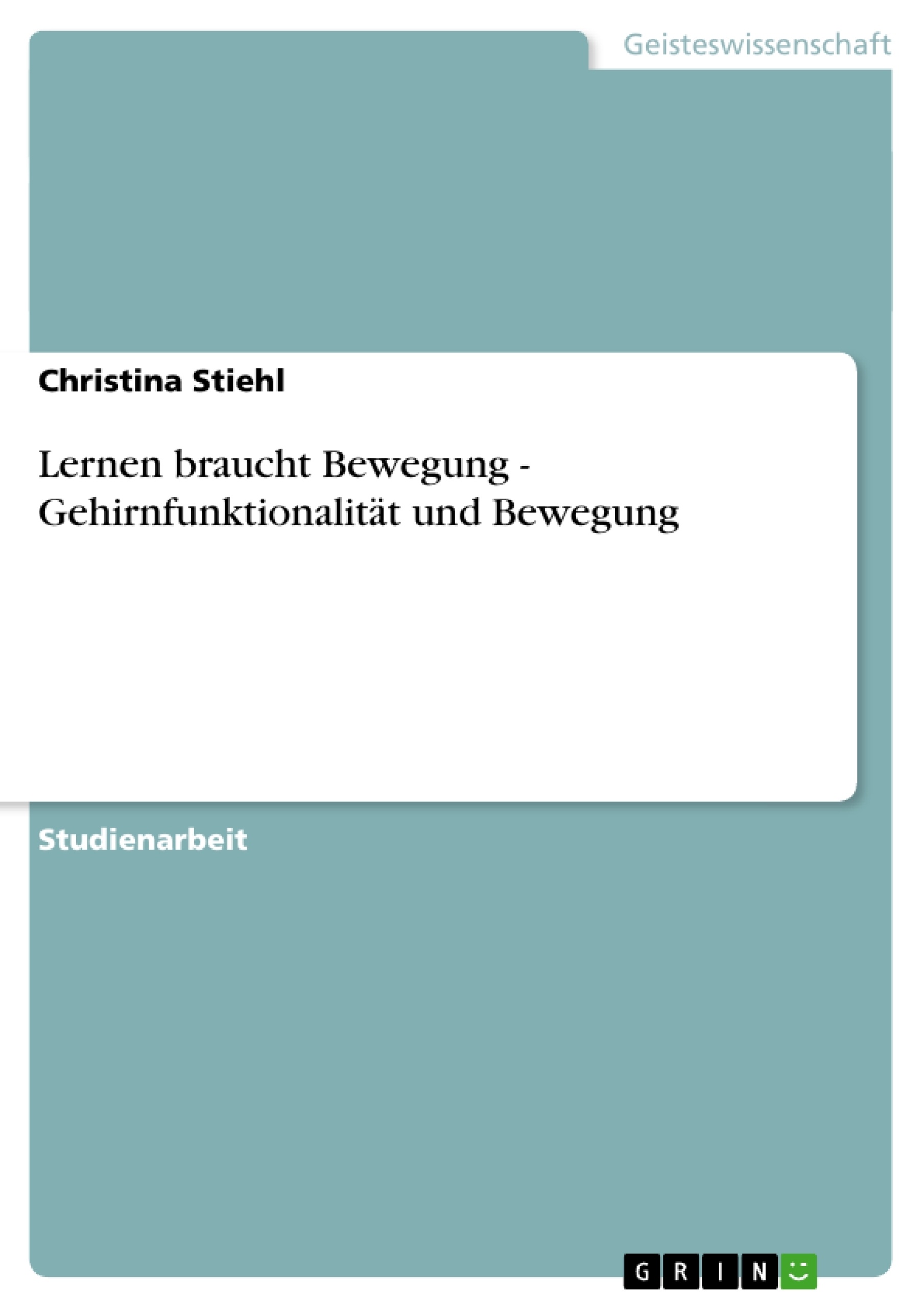Die vorliegende Hausarbeit behandelt die drei Schwerpunktthemen „Bewegen und Lernen“, „Gehirnfunktionalität“ sowie „Emotionale Kognition“.
Zur genaueren Anschauung, welche sensomotorischen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit ein Lebewesen überhaupt Bewegungen ausüben und lernen kann, habe ich diese in Punkt 2 beschrieben.
In Punkt 2.3 erkläre ich Piagets Stufenmodell zur kognitiven Entwicklung eines Menschen, gehe hierbei jedoch nur auf die ersten beiden Entwicklungsstufen ein, da hier die Grundlagen zur weiteren Ausreifung des Lernens und Bewegens gesetzt werden. Zum Abschluss diesen Punktes werde ich kurz die Erkenntnisse Piagets mit denen der neueren Gehirnforschung gegenüberstellen.
Der dritte Punkt „Gehirnfunktionalität“ befasst sich mit dem Aufbau und der Funktion des menschlichen Gehirns sowie dem lernenden Gehirn. Aus Platzgründen halte ich mich im ersten Teil eher allgemein und gehe nur auf das Großhirn, das von allen Teilen
des Gehirns am meisten entwickelt ist, genauer ein.
Im letzten Teil, der emotionalen Kognition, erläutere ich zunächst den Zusammenhang von Denken und Emotionen und werde anschließend in diesem Kontext die Erlebnispädagogik erläutern. Zuletzt beschreibe ich das Medium Klettern als eine der komplexesten Natursportarten der Erlebnispädagogik.
Zum Schluss werde ich in einem Fazit meine gesammelten Erkenntnisse zusammenfassen und sie kurz reflektieren.
1. Einleitung
Die vorliegende Hausarbeit behandelt die drei Schwerpunktthemen „Bewegen und Lernen“, „Gehirnfunktionalitat“ sowie „Emotionale Kognition“.
Zur genaueren Anschauung, welche sensomotorischen Voraussetzungen gegeben sein mussen, damit ein Lebewesen uberhaupt Bewegungen ausuben und lernen kann, habe ich diese in Punkt 2 beschrieben. In Punkt 2.3 erklare ich Piagets Stufenmodell zur kognitiven Entwicklung eines Menschen, gehe hierbei jedoch nur auf die ersten beiden Entwicklungsstufen ein, da hier die Grundlagen zur weiteren Ausreifung des Lernens und Bewegens gesetzt werden. Zum Abschluss diesen Punktes werde ich kurz die Erkenntnisse Piagets mit denen der neueren Gehirnforschung gegenuberstellen.
Der dritte Punkt „Gehirnfunktionalitat“ befasst sich mit dem Aufbau und der Funktion des menschlichen Gehirns sowie dem lernenden Gehirn. Aus Platzgrunden halte ich mich im ersten Teil eher allgemein und gehe nur auf das GroBhirn, das von allen Teilen des Gehirns am meisten entwickelt ist, genauer ein.
Im letzten Teil, der emotionalen Kognition, erlautere ich zunachst den Zusammenhang von Denken und Emotionen und werde anschlieBend in diesem Kontext die Erlebnispadagogik erlautern. Zuletzt beschreibe ich das Medium Klettern als eine der komplexesten Natursportarten der Erlebnispadagogik.
Zum Schluss werde ich in einem Fazit meine gesammelten Erkenntnisse zusammenfassen und sie kurz reflektieren.
2. Voraussetzungen zum Bewegen und Lernen
Dass Bewegen nicht nur gesund, sondern auch eng mit dem Lernen verknupft ist, bestatigt die neuere neurowissenschaftliche Forschung. Allerdings gelingt dies nur, wenn dem Menschen sensomotorische Voraussetzungen gegeben sind.
2.1 Bedeutung der Sinne
Der Mensch beginnt bereits im Mutterleib, sich zu bewegen. Zum Beispiel entsteht ab der achten Schwangerschaftswoche die Entwicklung des Gleichgewichtsorgans. Der Fotus nimmt Schwingungen sowie Bewegungen wahr und lernt, diese auch selbst auszulosen. Hierbei werden elektrische Impulse an das sich entwickelnde Gehirn transportiert, die es mit Energie versorgen. Somit reift das menschliche Gehirn bereits im Mutterleib, ausgelost durch Bewegungen (vgl. Damen 2004, S. 34).
Bereits pranatal, aber vor allem nach der Geburt sind Sinneseindrucke eines Sauglings nicht nur reine Wahrnehmungen, sondern setzen sich allmahlich im Gehirn fest: der Saugling erkennt zum Beispiel akustische und visuelle Empfindungen und reagiert darauf durch eigene Handlungen (vgl. Damen 2004, S. 34). Voraussetzung ist hierbei jedoch, dass das Kind einwandfrei wahrnehmen kann, also nicht beispielsweise im auditiven oder visuellen System beeintrachtigt ist und seine Sinne somit optimal entwickeln kann (vgl. Krammer 2004, S. 34). Eine Einschrankung der Horwahrnehmung kann zum Beispiel dazu fuhren, dass die sprachliche Kommunikation sowie im Schulalter der Schriftspracherwerb nicht ausreichend ausgepragt werden und dadurch erhebliche Schwierigkeiten fur das alltagliche Leben entstehen (vgl. Beigel 2008, S. 14- 15). Daruber hinaus stehen die Bereiche im Gehirn fur Spracherwerb, Koordination sowie Bewegung in unmittelbaren Zusammenhang zueinander, was zeigt, dass das eine ohne das andere nur schwer zu erlernen ist (vgl. Brandi o.A.)
Im Mutterleib entwickeln sich auch schon Erfahrungen, die pragend fur den zukunftigen Saugling und somit die neuronale Struktur sein konnen. Anlage und Umwelt stehen in einer permanenten Wechselwirkung zueinander und bedingen sich selbst (vgl. Damen 2004, S. 30).
Ein Kind hat ein angeborenes Bewegungsbedurfnis und ubt es eigenstandig aus. Durch diese Erfahrungen lernt es, mit seinem Korper und seinen Sinnen umzugehen, bildet stufenweise einen Zugang zur Welt und entwickelt sich im Idealfall zu einem gesunden Individuum, indem es solche Erfahrungen „mit seinem Leib und seiner Seele, seiner ganzen Person macht“ (vgl. Beins 2008, S. 6 und S. 8).
2.2 Bedeutung der Bewegungssteuerung
Ein gesunder Saugling macht in den ersten zwolf bis 15 Lebensmonaten einen enormen motorischen Schub: zunachst beginnt es, sich zu rollen, anschlieBend lernt es zu sitzen, zu krabbeln und schlussendlich zu laufen (vgl. Engelmayer 1964, S. 43 sowie Myers 2004, S. 156). Die Gelenke und Muskeln des Sauglings mussen zum Erlernen dieser Eigenschaften ausreichend entwickelt sein, damit Bewegungen ausgefuhrt werden konnen und zu einer unbewussten Selbstverstandlichkeit werden (vgl. Heuer 2006, S. 529). Motorische Modifikationen sind offensichtlich entweder Gedachtnisinhalte, die sich exakt identifizieren und zuordnen lassen oder neuronale Netzwerke, die durch Synapsen an verschiedene „Kreise“ angeschlossen sind (vgl. Heuer 2006, S. 532).
Eine Bewegung ist bereits direkt zu Beginn der Ausfuhrung an auf nachfolgende Situationen angeglichen. Dies geschieht unbewusst und automatisch. Hierbei werden Bewegungen vor allem so ausgefuhrt, dass es fur den Menschen am angenehmsten und unproblematischsten ist („end- state- comfort“) (vgl. Heuer 2006, S. 532- 533).
2.3 Entwicklungsstufen nach Piaget
Jean Piaget, ein schweizer Entwicklungspsychologe (gest. September 1980), unterscheidet insgesamt vier Stufen der kognitiven Entwicklung (vgl. Brandi o. A.). Diese gehen vor allem durch Bewegung einher: „Nur, wer einen Stein geschleppt hat, weiB, was ein Stein ist“ (vgl. Seewald 2003, S. 2). Im Folgenden gehe ich auf die ersten beiden Stufen Piagets ein, da diese ausschlaggebend fur die kognitive Entwicklung des Menschen sind. Im Verlauf der Sozialisation lost sich dieser Kontext, allerdings wird es nie komplett bedeutungslos (vgl. Seewald 2003, S. 3).
[...]