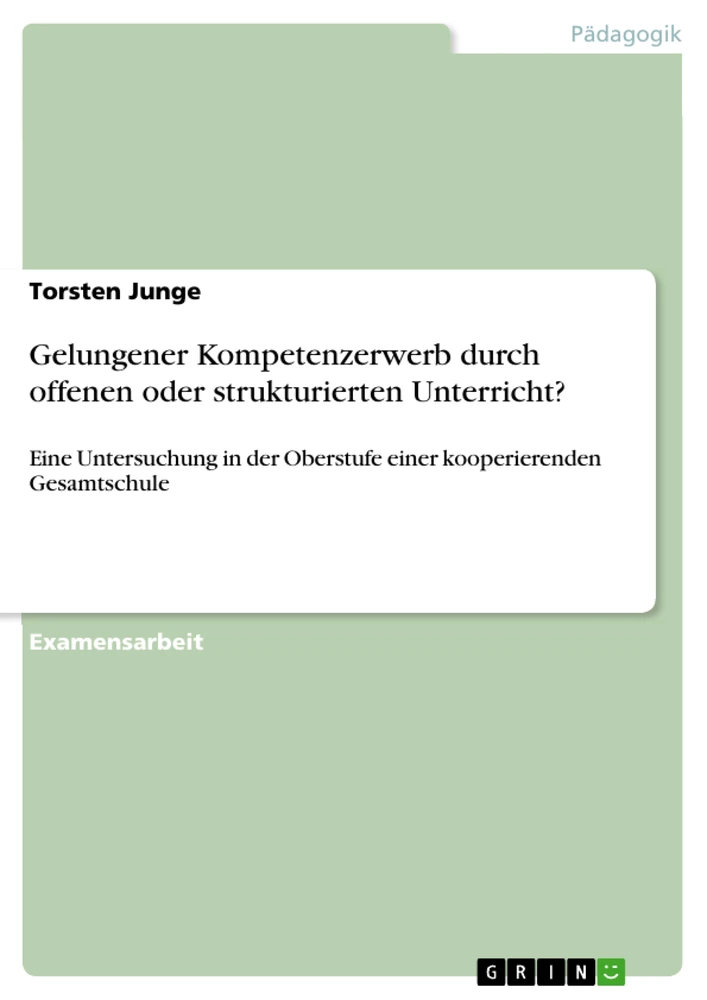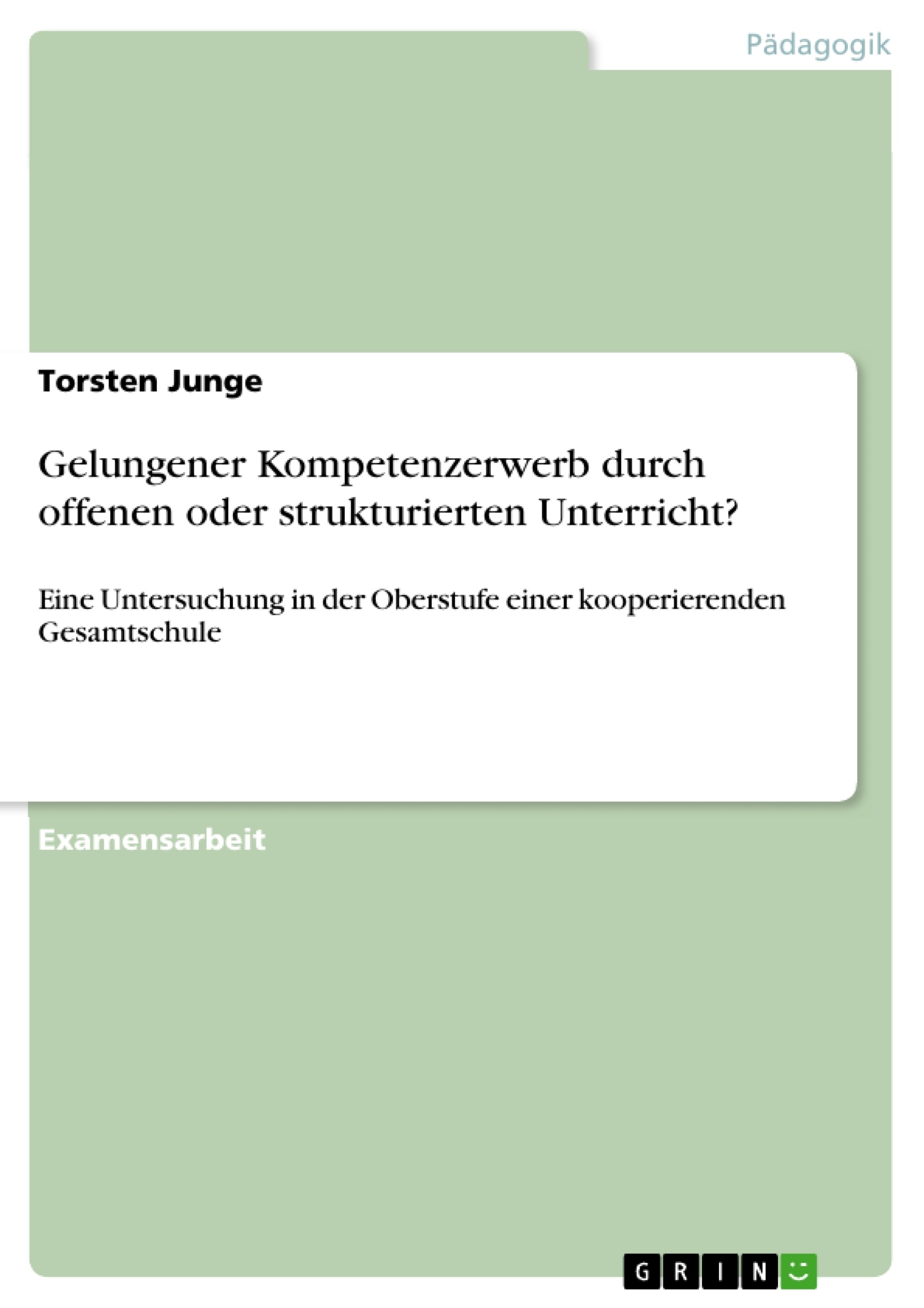„Offener Unterricht ist in Perfektion nur in entschulten Situationen vorstellbar“ (Ramsegger 1992: 26). Die immer noch zutreffende Aussage Ramseggers wirft sofort die Frage auf, ob die Rede vom geöffneten Lernen, vom offenen Unterricht, nicht ein Antagonismus, auf der sprachlichen Ebene ein Oximoron darstellt, dessen schwunghafte Karriere einzig seiner pla-kativen Neuartigkeit geschuldet ist. Nichtsdestoweniger soll in dem hier reflektierten unter-richtsversuch die Stärken eines geöffneten Unterrichts ausgelotet werden. Unterricht in der Institution Schule ist durch Strukturen gekennzeichnet: Das beginnt beim Stundenklingel und hört bei den schriftlich festgehaltenen Erwartungen hinsichtlich der zu erlernenden Wissens-bestände und Kompetenzen auf. Diesen Unterricht nun zu öffnen, ist ein Grundtenor zeitge-nössischer Vorstellung von Schule, und doch bleibt der Anspruch aufgrund der gegenwärtigen institutionellen Situation kaum eingelöst. Im Folgenden geht es darum, in kleine Schritten auf die Potentiale und Fallstricke des geöffneten Unterrichtes zu verweisen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Voruberlegungen und konzeptionelle Uberlegungen
2.1 Die Erfordemisse eines sich wandelnden Bildungsbegriffes - Forschungshypothesen
2.2 Gesellschaftstheoretische wie allgemeindidaktische Rahmenbedingungen
2.3 Didaktischer Paradigmenwechsel? Der offene Unterricht als individualisierter Unterricht
2.4 Strukturierter und offener Unterricht - (k)ein Widerspruch?
2.4.1 Der strukturierte Unterricht
2.4.2 Der geoffnete Unterricht
3 Anlage der Untersuchung
3.1 Evaluation und Indikatoren - Begrundung
4 Anlage der Unterrichtseinheit
4.1 Angaben zur Lerngruppe
4.2 Thema der Unterrichtseinheit und Einbettung in die Gesamtplanung
4.3 Begrundung der didaktischen Entscheidungen
4.3.1 Sachanalytische Hinweise
4.3.2 Didaktische Entscheidungen
4.4 Begrundung der Methoden- und Medienauswahl
4.6 Uberblick uber den Verlauf der Unterrichtseinheit
5 Auswertung der Unterrichtseinheit
5.1 Freies Arbeiten oder strukturiertes Lernen - meine Beobachtungen
5.2 Die Meinung der ExpertInnen
5.2.1 Vorteile des geoffneten Unterrichtes
5.2.2 Schwierigkeiten geoffneten Unterrichtes
6 Schlussfolgerungen
6.1 Neujustierung von SchulerInnen- und LehrerInnenrolle
7 Fazit
8 Literatur