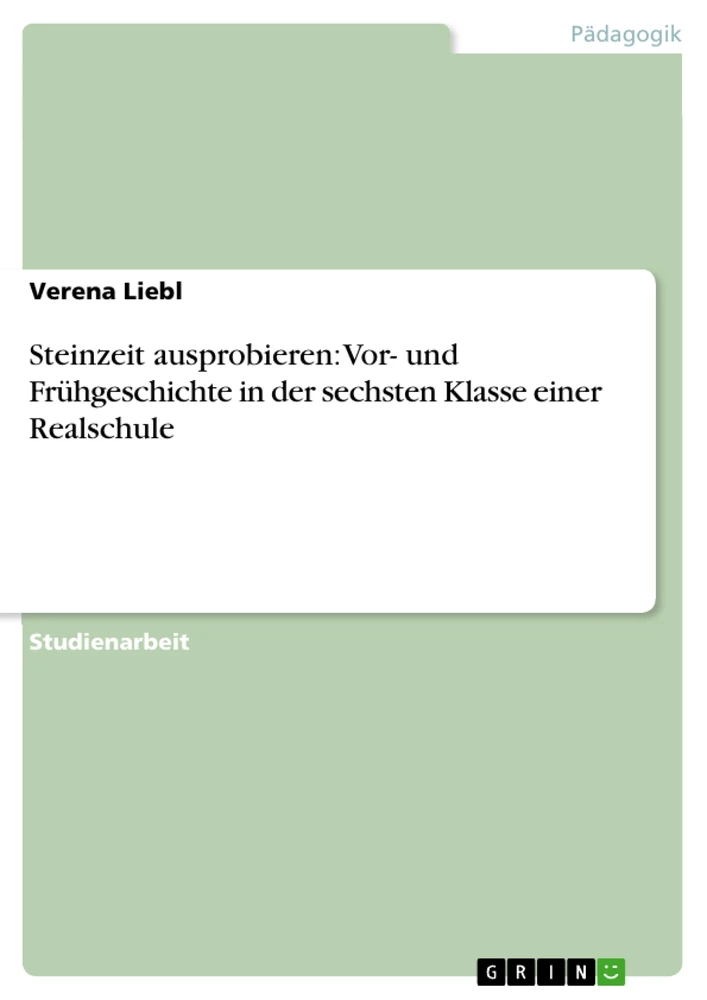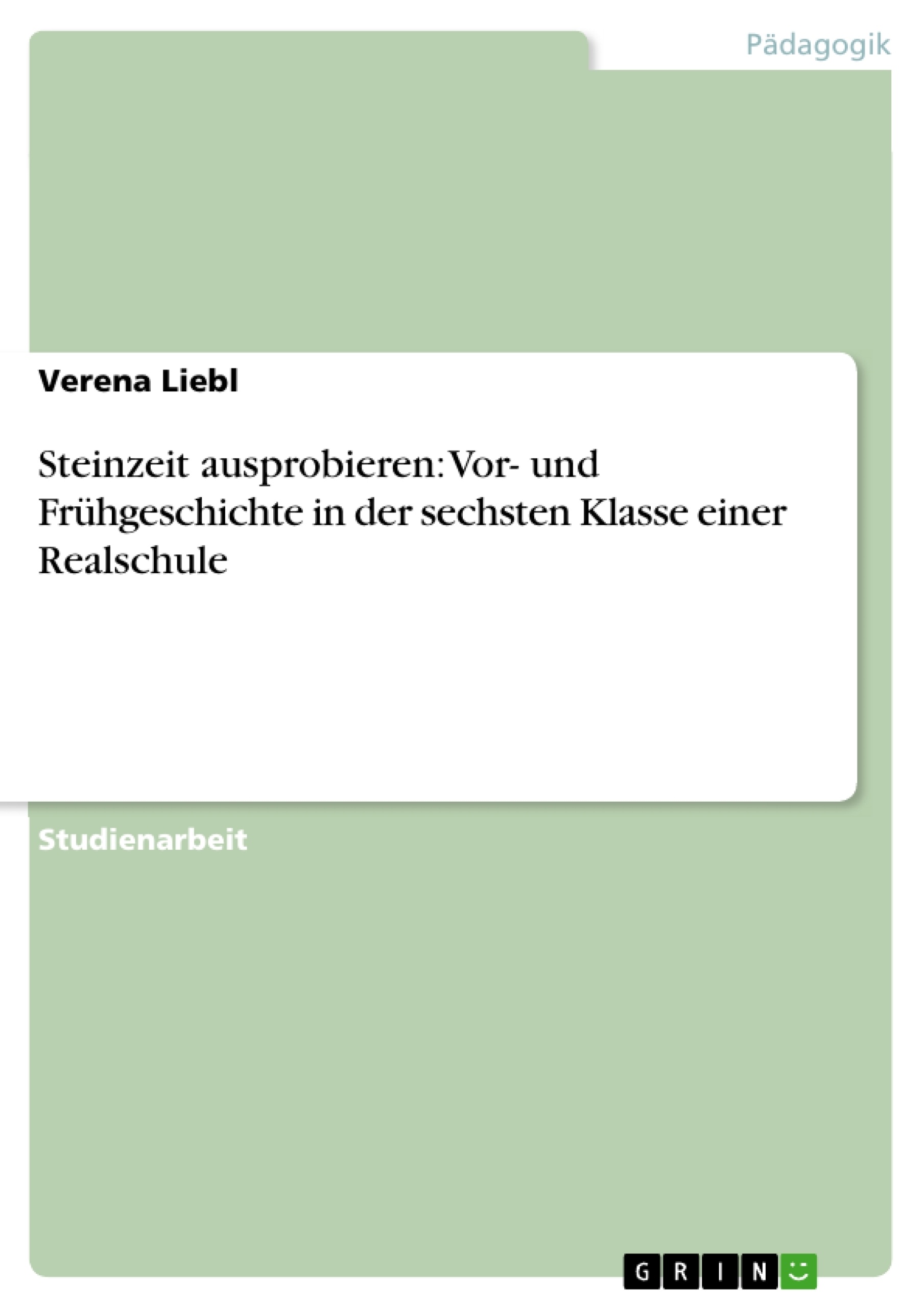Einleitung
Die ersten Nachweise für das "Wohnen in der Steinzeit" können im Zeitalter des Paläolithikums festgemacht werden, nämlich in Form der sogenannten "Höhlenwohnungen". Die Menschen lebten in dieser Zeit noch als Nomaden, mussten für ihr Überleben Tiere jagen und waren deshalb auf Schlafgelegenheiten angewiesen, die ihnen die Natur bot. Dafür wählten sie meist sogenannte "Abris" aus. ...
Inhalt
1. Pflichtbereich
1.1 Aufgabe 1: Kurze Vorstellung des Referatthemas „Längsschnitt - Veränderung des Wohnens (Höhle-Hütte-Haus-Palast)?“
1.2 Aufgabe 2: Mögliche Sequenzplanung zum Themenbereich „Vor-/
Frühgeschichte“
1.3 Aufgabe 3: Darlegung der pädagogisch- didaktischen Vorzüge des Unterrichts
zur Vor-/ und Frühgeschichte
1.4 Aufgabe 4: Reflexion des Seminars und Darstellung der Bedeutung der
Steinzeit für die Schule
2. Wahlbereich
2.1 Aufgabe 1: Vorschläge zu „Tafelbildern“ zu unterschiedlichen Themen der
Vor- und Frühgeschichte in der Realschule
2.2 Aufgabe 2: Vergleich/Beurteilung verschiedener Schulbuchkapitel
3. Literatur