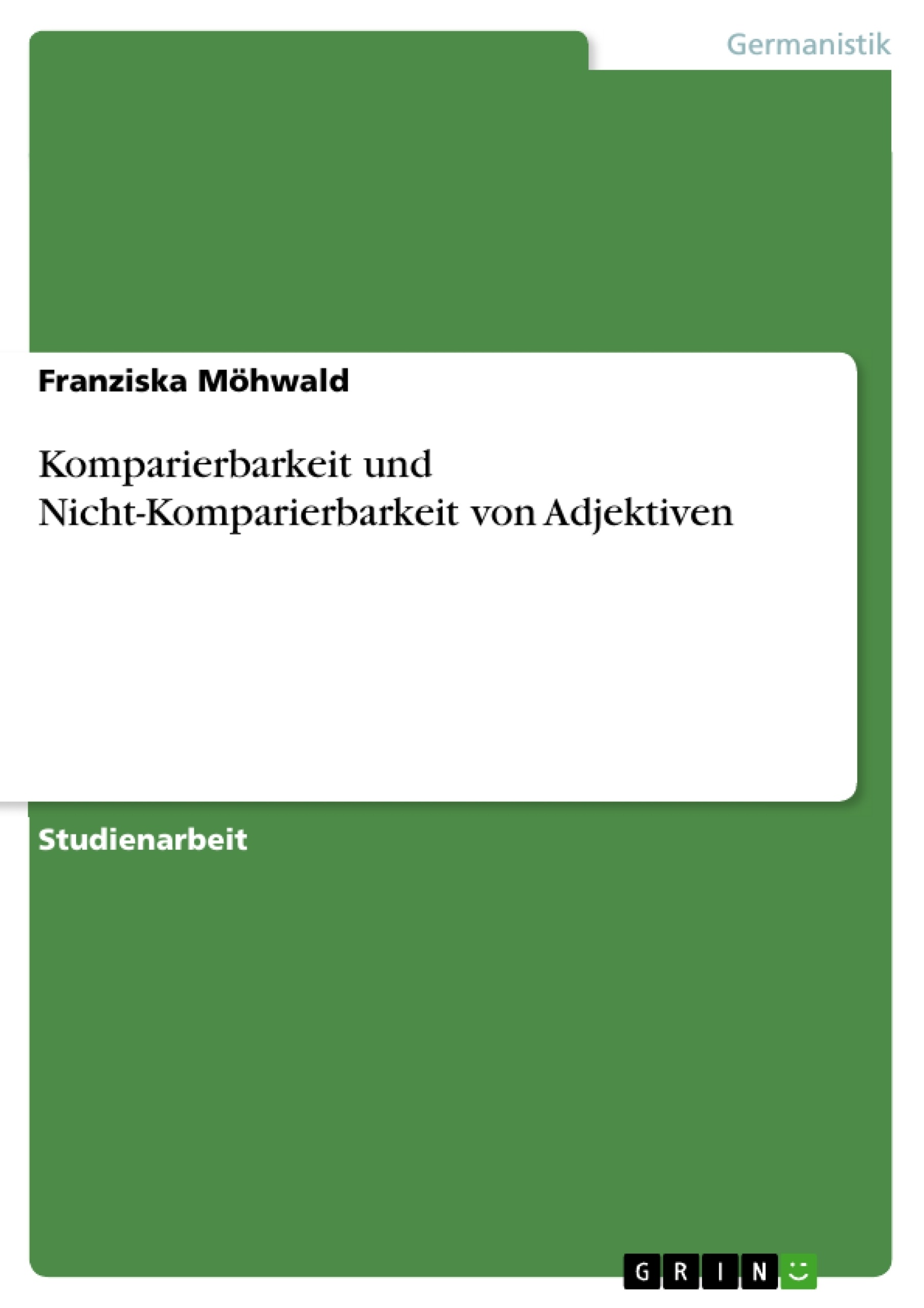Adjektive sind in ihrer semantischen und syntaktischen Bedeutung für den Sprachgebrauch unerlässlich. Sie machen aus einem Sonntagmorgen, den sonnigsten Tagesbeginn seit langem und aus einem Essen, ein schmackhafteres Erlebnis.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die genannten Graduierungen der Adjektive, die in der Sprachwissenschaft als Komparation bezeichnet werden. Dabei soll den Fragen nachgegangen werden, was man unter Komparation versteht, welche Stufen es gibt, wie sie gebildet und verwendet werden und welche Ausnahmen und Besonderheiten zu beachten sind?
Im Besonderen sollen die morphologischen Prozesse, die bei der Komparation eine Rolle spielen in den Blick genommen werden. Die Ergebnisse sollen dann zu einem Überblick über die Komparation und Nicht-Komparation von Adjektiven zusammengefasst werden.
Als Grundlage dienen die Überblicksdarstellungen zur deutschen Grammatik von Peter Eisenberg, Elke, Hentschel/Harald Weydt , Walter Flämig und Gerhard Helbig /Joachim Bucha . Dazu zählt auch die Ausgabe zur Grammatik des Dudenverlages. Als weiterführende Literatur zur Morphologie dienten die Monographien von Elke Hentschel/Petra Vogel und Franz Simmler. Den einleitenden Bemerkungen zur Fragestellung, thematischer Eingrenzung, zum Forschungsstand und der Vorgehensweise folgt eine Definition des Begriffs Komparation. Es soll dabei geklärt werden, was unter Komparation zu verstehen ist und welchen Stufen der Komparation man unterscheidet. In Ansätzen wird die Forschungsdiskussion zur Zuordnung der Komparation zur Flexion oder Wortbildung wiedergegeben.
In Kapitel 3 werden dann die einzelnen Komparationsstufen hinsichtlich ihrer Bildung und Verwendung untersucht. Das Kapitel 4 befasst sich mit den Ausnahmen und Besonderheiten der Komparativbildung. Dort bilden die Suppletivformen und die nicht-komparierbaren Adjektive den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Schlussbetrachtung dient der Zusammenfassung der Ergebnisse und dem Bezug auf die Fragestellung des ersten Kapitels.
Komparierbarkeit und Nicht-Komparierbarkeit von Adjektiven
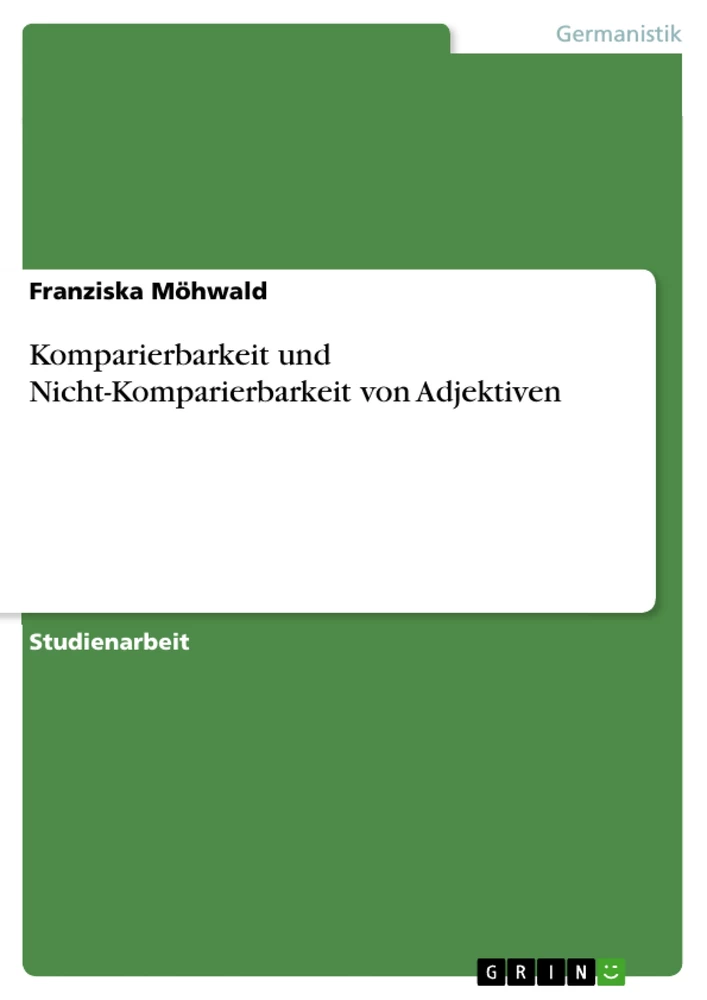
Hausarbeit (Hauptseminar) , 2010 , 10 Seiten , Note: 2,0
Autor:in: Franziska Möhwald (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch