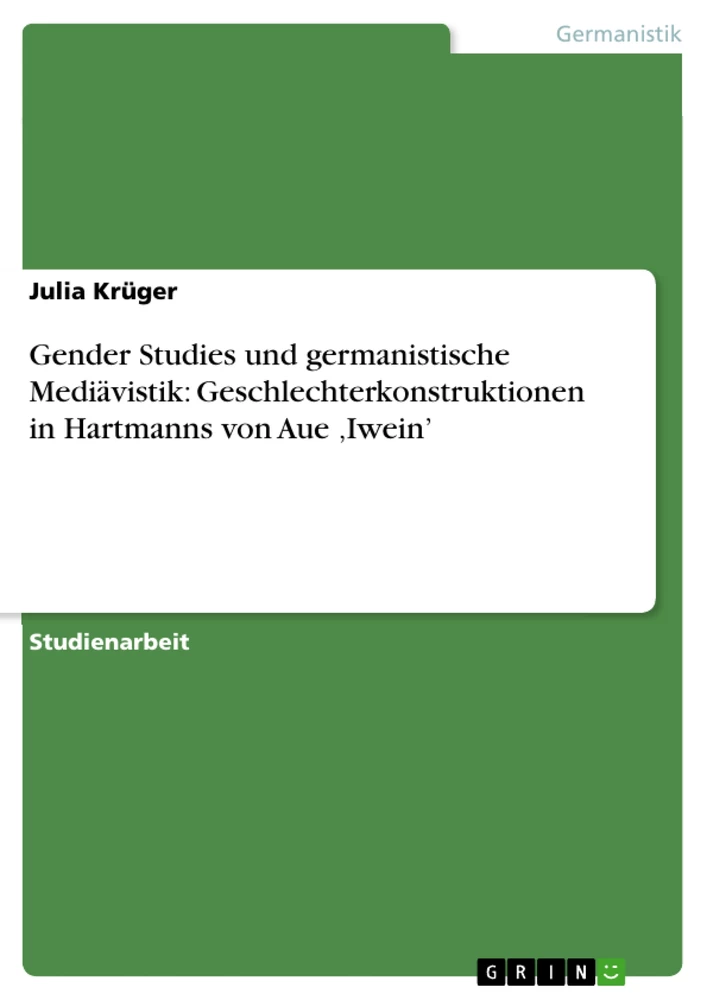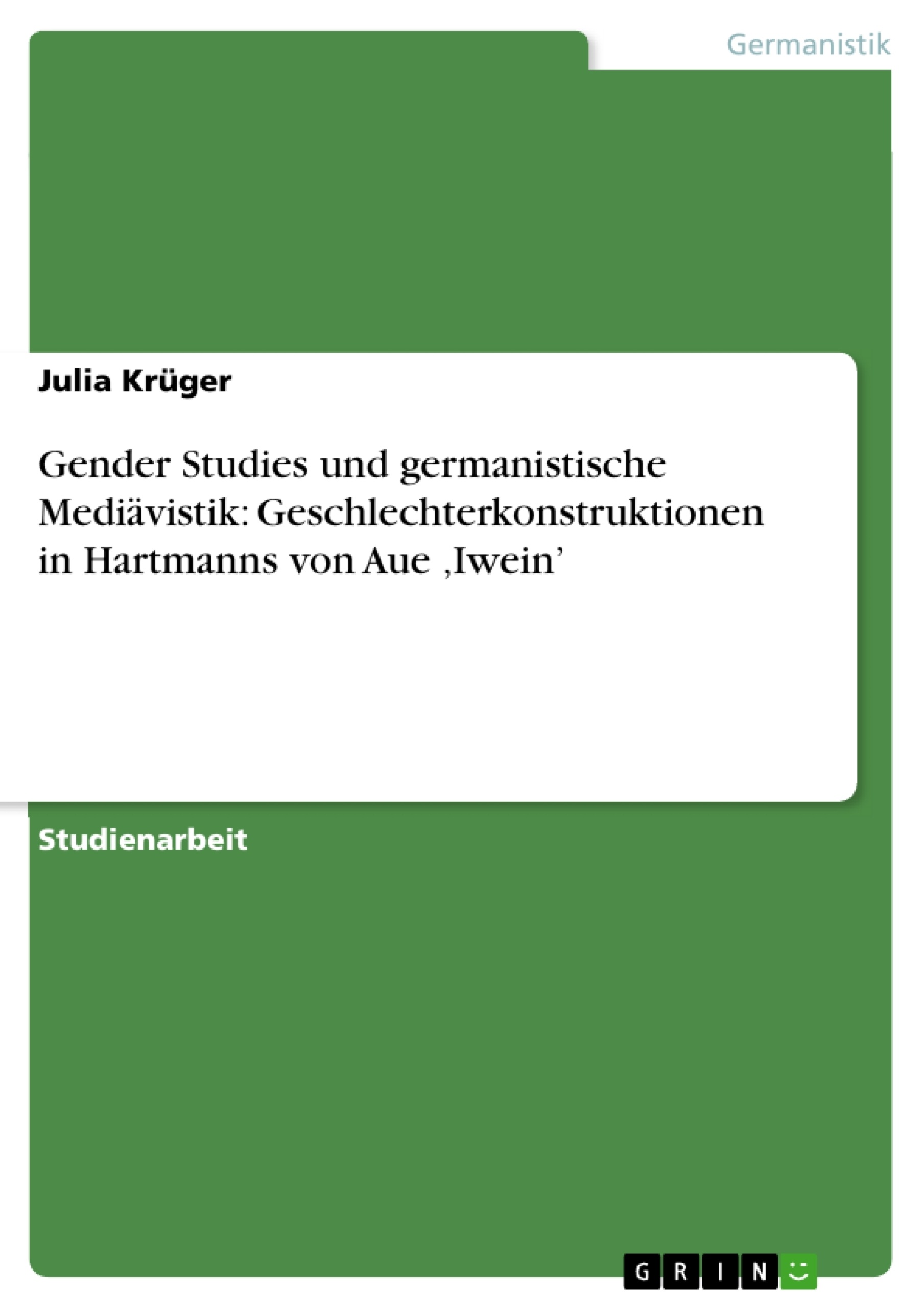Die Gender Studies (oder auch Geschlechterforschung) gingen aus dem Feminismus der USA in den 1970er-Jahren hervor. Ein Jahrzehnt später etablierte sich diese Disziplin auch im deutschsprachigen Raum. Grundlegender Gedanke war es, die binären Geschlechterverhältnisse zu ergründen, herauszufinden, warum eine hierarchische Anordnung zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften besteht sowie zu klären, inwiefern das biologische Geschlecht als persönliche Eigenschaft angesehen werden kann und darf. Ein Bezug zu Disziplinen außerhalb der Sozialwissenschaften ist insofern geeignet, da sich die Geschlechterverhältnisse auf alle Lebensbereiche ausbreiten. Es erscheint daher als durchaus sinnvoll, auf Basis der Gender Studies interdisziplinär zu forschen.
Wie lässt sich diese sehr junge wissenschaftliche Fachrichtung nun auf die germanistische Mediävistik übertragen? Judith Butler (1991) und Thomas Laqueur (1992) gaben dazu den entscheidenden Anstoß. Butler betonte die Performativität der sozialen Geschlechtsidentität im Zusammenhang mit den biologischen Gegebenheiten des menschlichen Körpers. Geschlechterdifferenzen werden demnach aufgrund sprachlicher Gegebenheiten hervorgebracht. Eine biologische Vorgabe der Unterscheidung der Geschlechter ist nach Butler nicht existent. Sprachliche Unterscheidungen werden von der Gesellschaft auf die biologischen Gegebenheiten übertragen und als unveränderlich dargestellt. Da diese Unveränderbarkeit aber über die Sprache künstlich erzeugt wird, ist die binäre Unterscheidung der Geschlechter sehr wohl veränderbar. Laqueur legt mit der medizinhistorischen Sichtweise dar, dass im Mittelalter die Vorstellung eines Ein-Geschlecht-Modells (one-sex-model) vorherrschte, wonach die Frau als minderwertige Ausführung des Mannes angesehen wurde. Während Butler die sex/gender-Unterscheidung grundsätzlich kritisiert, analysiert Laqueur die Vorstellung über die Kategorie ‚sex’ in der Historie.
In dieser Hausarbeit soll es überwiegend um die Forschungspositionen der mediävistischen Gender Studies gehen. Demnach gehe ich zunächst auf die soziologische Perspektive der Gender Studies ein. Die Begriffe ‚sex’ und ‚gender’ werden geklärt und die soziokulturelle Konstruktion von Geschlechtern erläutert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Gender Studies und germanistische Mediävistik
2.1. Soziologische Perspektive
2.2. Butler und Laqueur – Verbindungen der Gender Studies mit der germanistischen Mediävistik
2.3. Forschungspositionen der mediävistischen Geschlechterforschung
3. Laudine und die Rolle der Frau im Mittelalter
3.1. Frauen im Mittelalter
3.2. Laudine als Beispiel für die Rolle der Frau im Mittelalter
4. Geschlechterkonstruktionen in Hartmanns ‚Iwein’
4.1. Körperliche Schwäche als Weiblichkeit?
4.2. Körperliche Stärke als Männlichkeit?
4.3. Rolle der Frauengestalten für die Entwicklung der Figur Iwein
5. Resümee und Ausblick
6. Literaturverzeichnis