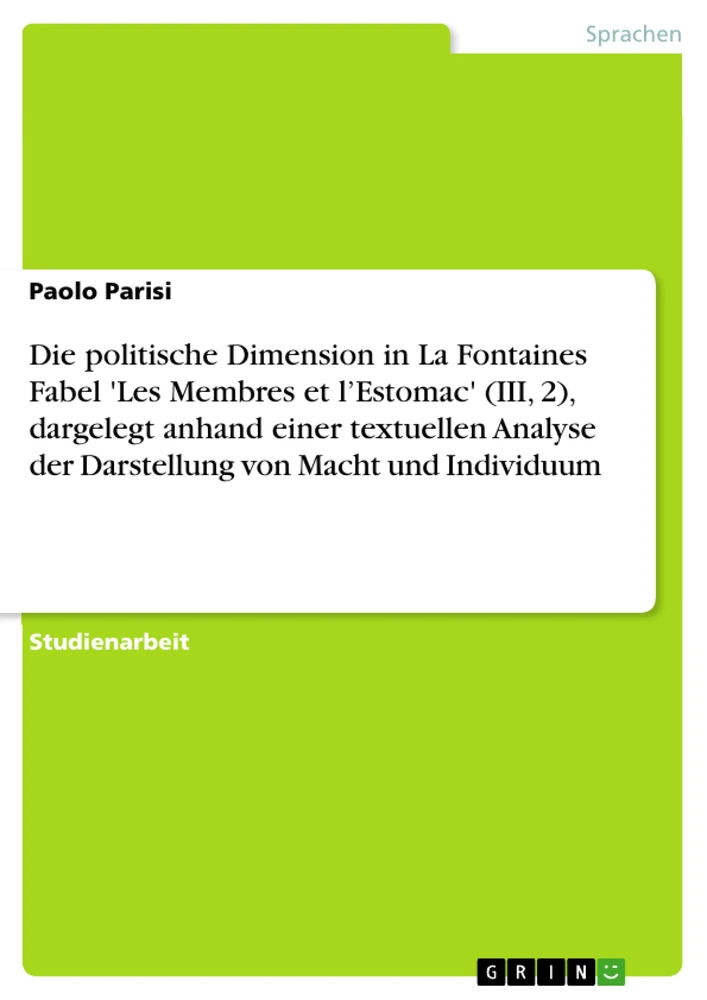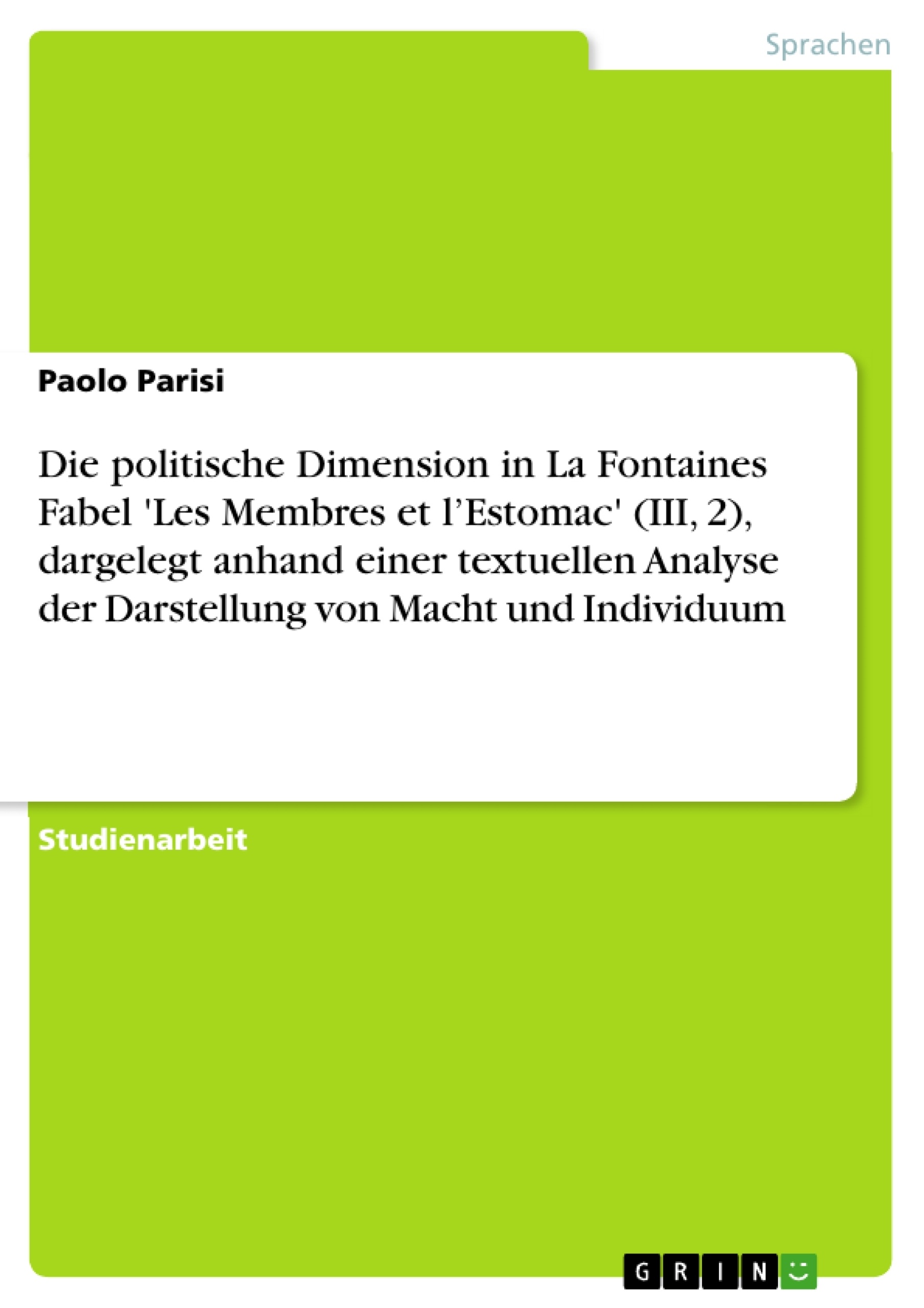Diese Arbeit geht der Frage nach, inwiefern in angegebener Fabel die Darstellung von (politischer) Macht, gegenüber dem Individuum, als ein für die Interpretation der Fabel wichtiger Bezugspunkt angesehen werden kann. Hierbei wird in erster Linie auf von der bisherigen Forschung als zweideutig auslegbare Eigenheiten der Fabel -so z.B. die Darstellung des Messer Gaster - Bezug genommen und textuell interpretiert.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Messer Gaster la grandeur Royale?
3. Der Magen und die Glieder
4. ›Orator in fabula‹ - Politische Rhetorik versus literarische Form
5. Macht und Individuum
6. Schluss
7. Anhang
8. Literaturverzeichnis