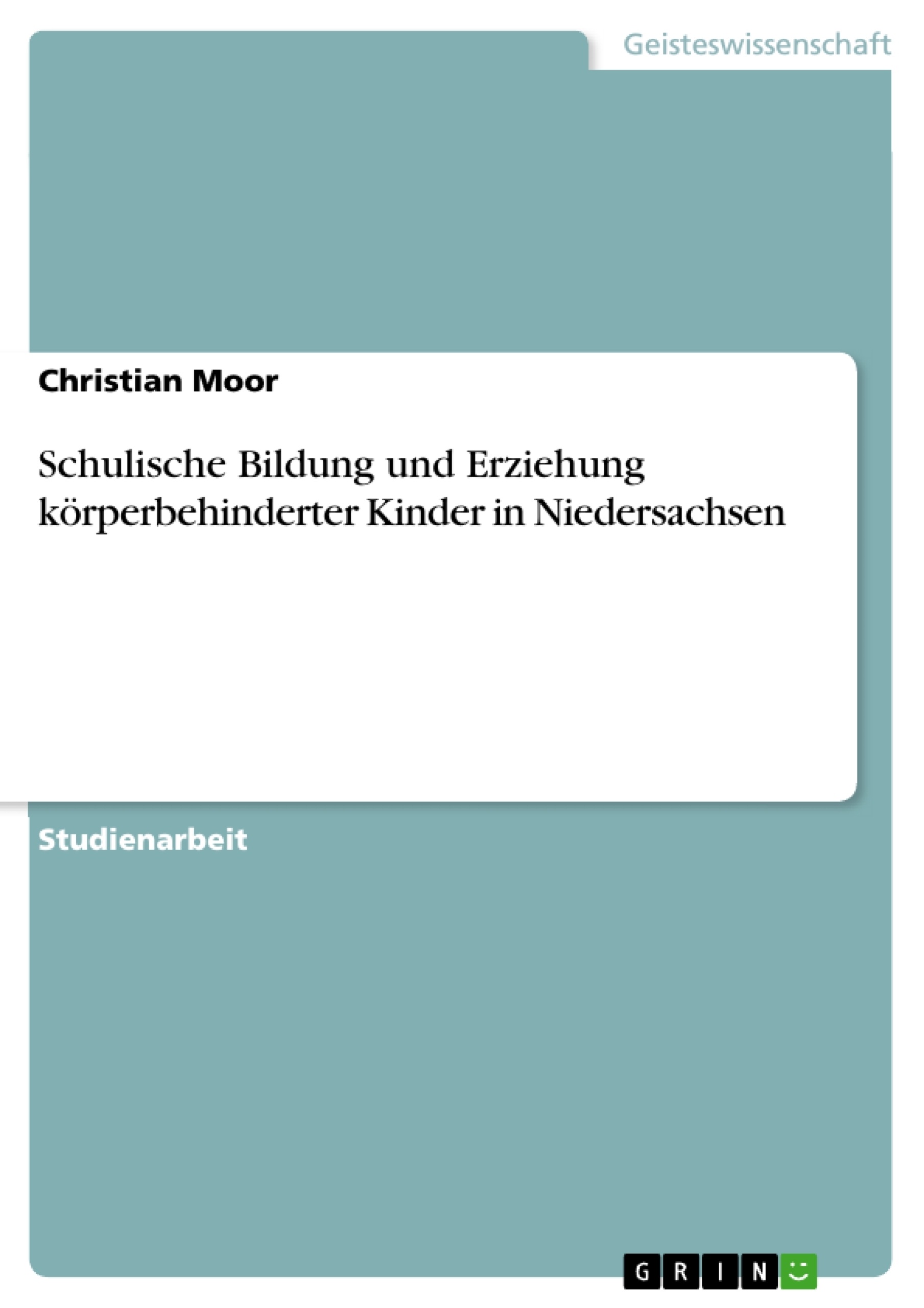1.Einleitung
Auch nach den diesjährigen Sommerferien beginnt für viele Kinder die Schulzeit. Etliche Eltern haben Überlegungen angestellt, welche Schule die beste für ihr Kind sei.Dabei ist die Wahl allerdings durch Schuleinzugsgebiete eingeschränkt.
In besonderer Weise stellt sich die Frage nach der „besten“ Schule bei Kindern mit Behinderungen. Ist es die Förderschule oder z.B. die Grundschule in der Nachbarschaft? Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden, so steht es im Grundgesetz .Aber stimmt das so?
Des Weiteren heißt es im Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 20.03.98: „Alle Kinder haben – unabhängig von Art und Schweregrad ihrer Behinderung das Recht auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten entspre-chende schulische Bildung und Erziehung“.
Verwirklicht werden soll dieses Recht mithilfe von sonderpädagogischer Förderung.
Aber:
•Wie sieht das in der Praxis aus?
•Welche Probleme, welche Möglichkeiten gibt es?
•Wovon ist es abhängig, an welchem Ort ein behindertes Kind wie beschult wird?
•Was ist überhaupt unter dem Begriff „Behinderung“ zu verstehen?
Im Rahmen meiner Hausarbeit mache ich dazu Ausführungen, beschränke mich jedoch aufgrund der Komplexität des Themas auf die schulische Bildung und Erziehung körperbehinderter Kinder in Niedersachsen.
2.Zur Situation körperbehinderter Kinder sowie deren Eltern zu Beginn der Schulpflicht
Allgemein wird jemand als behindert angesehen, der nicht nur eine vorübergehende Beeinträchtigung erfährt und der von körperlichen, organischen und Verhaltensmustern in der Selbstverwirklichung eingeschränkt ist.
Schulische Bildung und Erziehung körperbehinderter Kinder in Niedersachsen
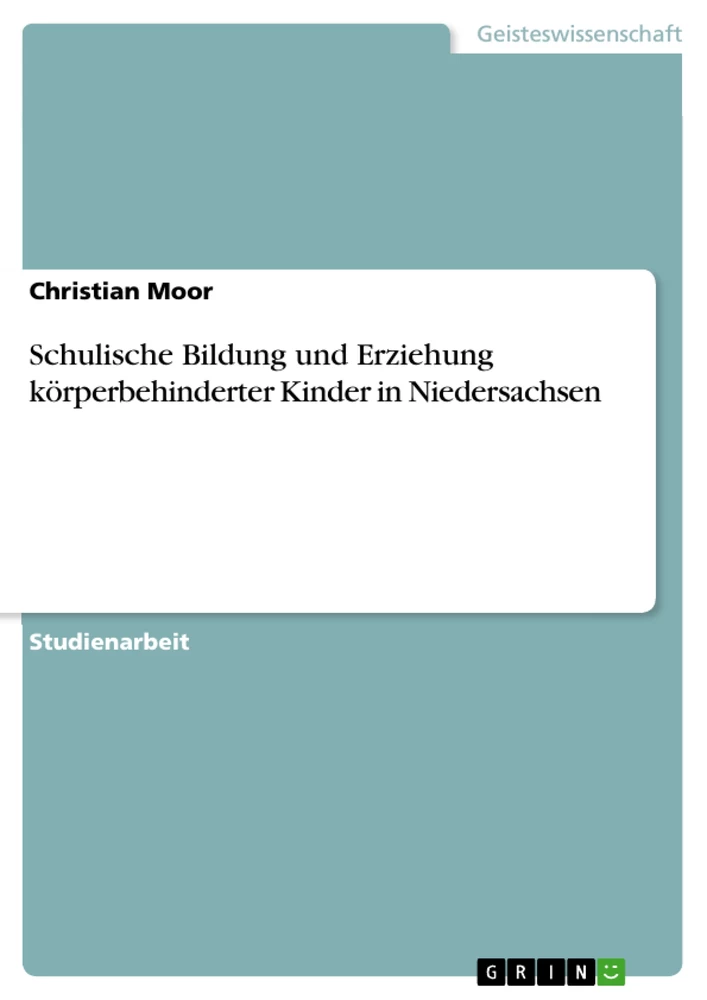
Hausarbeit , 2009 , 9 Seiten , Note: 2,3
Autor:in: Christian Moor (Autor:in)
Leseprobe & Details Blick ins Buch