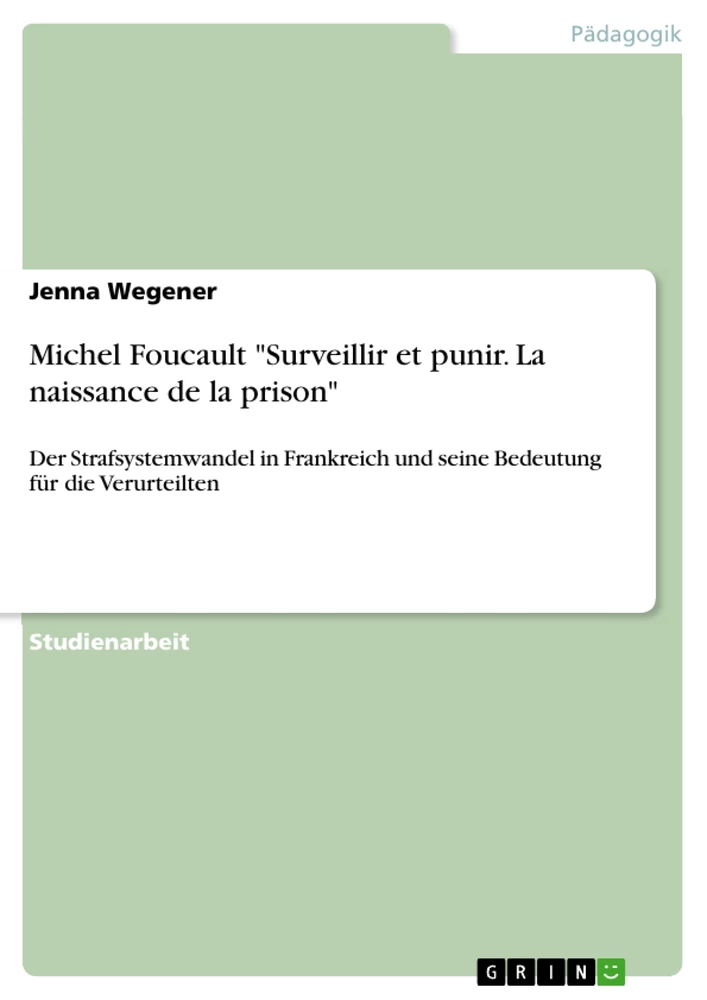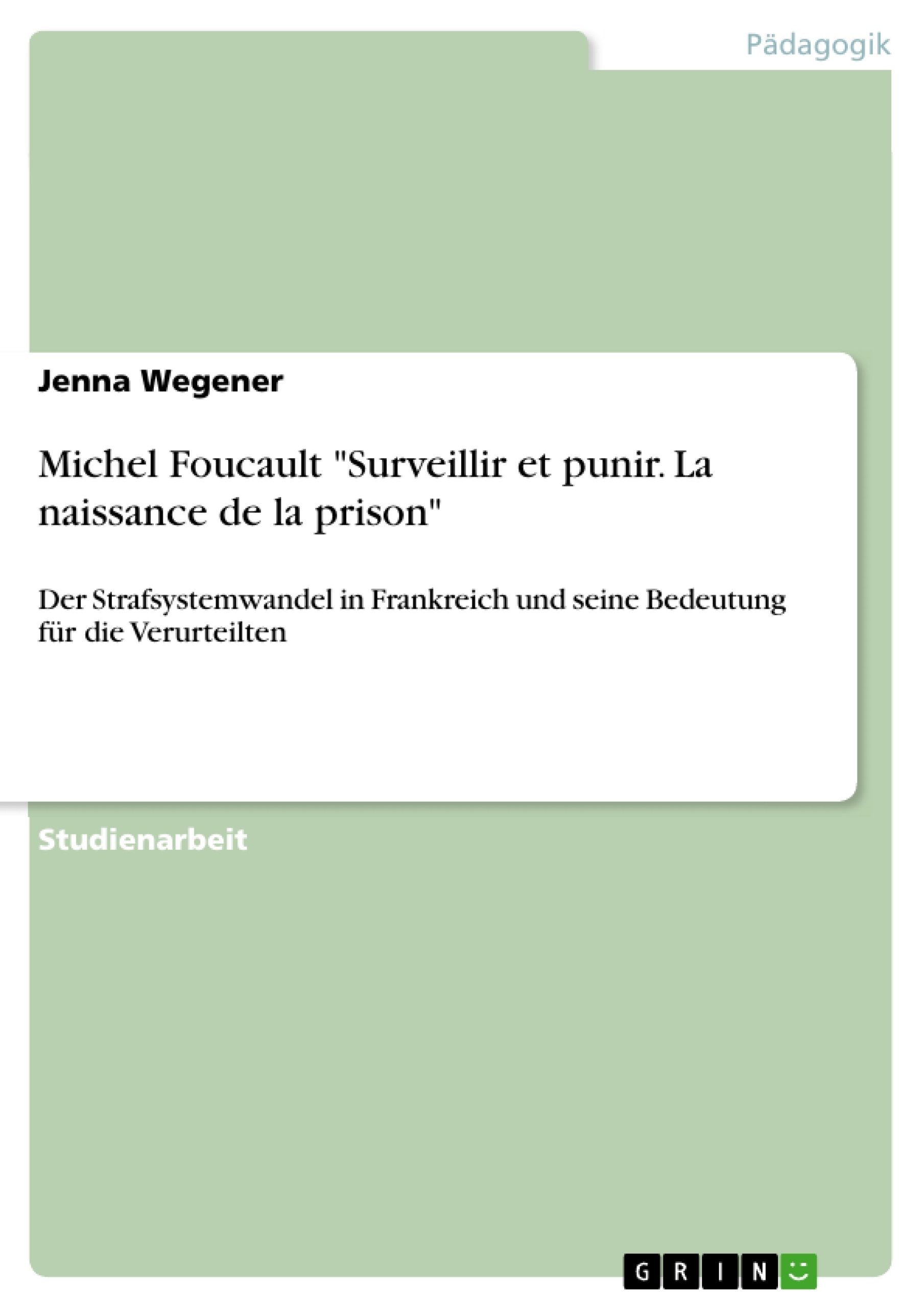Das 1975 erschienende Werk Surveillir et punir- La naissance de la prison von Michel Foucault beschäftigt sich mit der Entstehung des modernen Strafsystems und somit gleichsam mit der Frühentwicklung der Haftanstalten.
Michel Foucault beschreibt und analysiert in diesem Werk die Entwicklung einer neuen Strafpraxis vorrangig am Beispiel Frankreichs, die im Europa des späten 18. Jahrhunderts beginnend, sukzessiv die öffentlich vollzogene Strafform der Marter durch die Verhängung von Haftstrafen ersetzte.
Die vorliegende Arbeit möchte aber nicht nur den Übergang von der körperlichen Strafe zur Inhaftierungsstrafe anhand von Michel Foucaults Ausführungen erklären, sondern ein besonderes Augenmerk auf die daraus resultierenden Bedingungen für die Verurteilten legen.
Um diesen Aspekt herausstellen zu können, wird im ersten Teil der Arbeit zunächst die Durchführung der Marter am Beispiel der Hinrichtung von Robert François Damiens beschrieben, der 1757 aufgrund eines Anschlages auf den damaligen König in Frankreich öffentlich zu Tode gefoltert wurde. In diesem Zusammenhang werden die Hintergründe und Ziele, die mit dieser Strafform vom damaligen Staatsoberhaupt verfolgt wurden aufgezeigt.
Im weiteren Verlauf der Arbeit soll dann der Ablauf des Strafsystemwandels dargelegt werden, der sich im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert in Europa vollzog und dessen Folgen die Straffrom der Marter immer mehr zurückdrängten. Die Gründe, die dafür verantwortlich waren, dass das Strafschauspiel der peinlichen Strafe zunehmend aus der Öffentlichkeit verschwand und schließlich völlig von der neuen Strafform-der Haftstrafe abgelöst wurde, werden in diesem Kontext näher erläutert: Wie und warum änderte sich die Strafpraxis und was bedeutete die neue Strafform konkret für das Subjekt des Verurteilten? Um diese Fragen beantworten zu können wird im letzten Teil der Arbeit die Form der Haftstrafe und damit einhergehend die neuen Bedingungen für den Verurteilten näher beleuchtet. In einem abschließenden Fazit soll dann noch einmal herausgestellt werden, welche konkreten Unterschiede die beiden Strafformen aufweisen und wie sich diese im Hinblick auf die Faktoren Raum, Öffentlichkeit und Selbstbesinnung auswirkten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Transformation des Strafsystems
2.1 Die Marter
2.2 Der Beginn eines neuen Strafsystemzeitalters
2.3 Weitere Gründe für die Veränderung des Strafsystems
2.4 Die Milderung der Strafen
3. Die Etablierung des neuen Strafsystems
3.1 Die Anfänge der Inhaftierungsanstalten in Frankreich
3.2 Die neue Strafpraxis und ihre Auswirkungen auf den Gefangenen
3.3 Das perfekte Gefängnis
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
6. Quellenverzeichnis