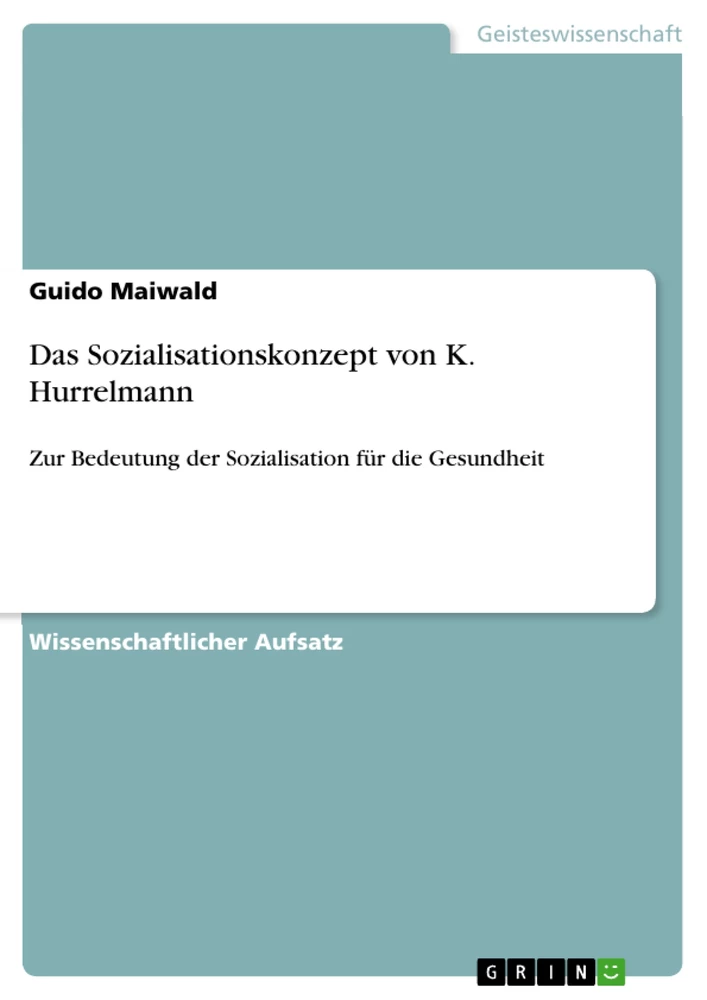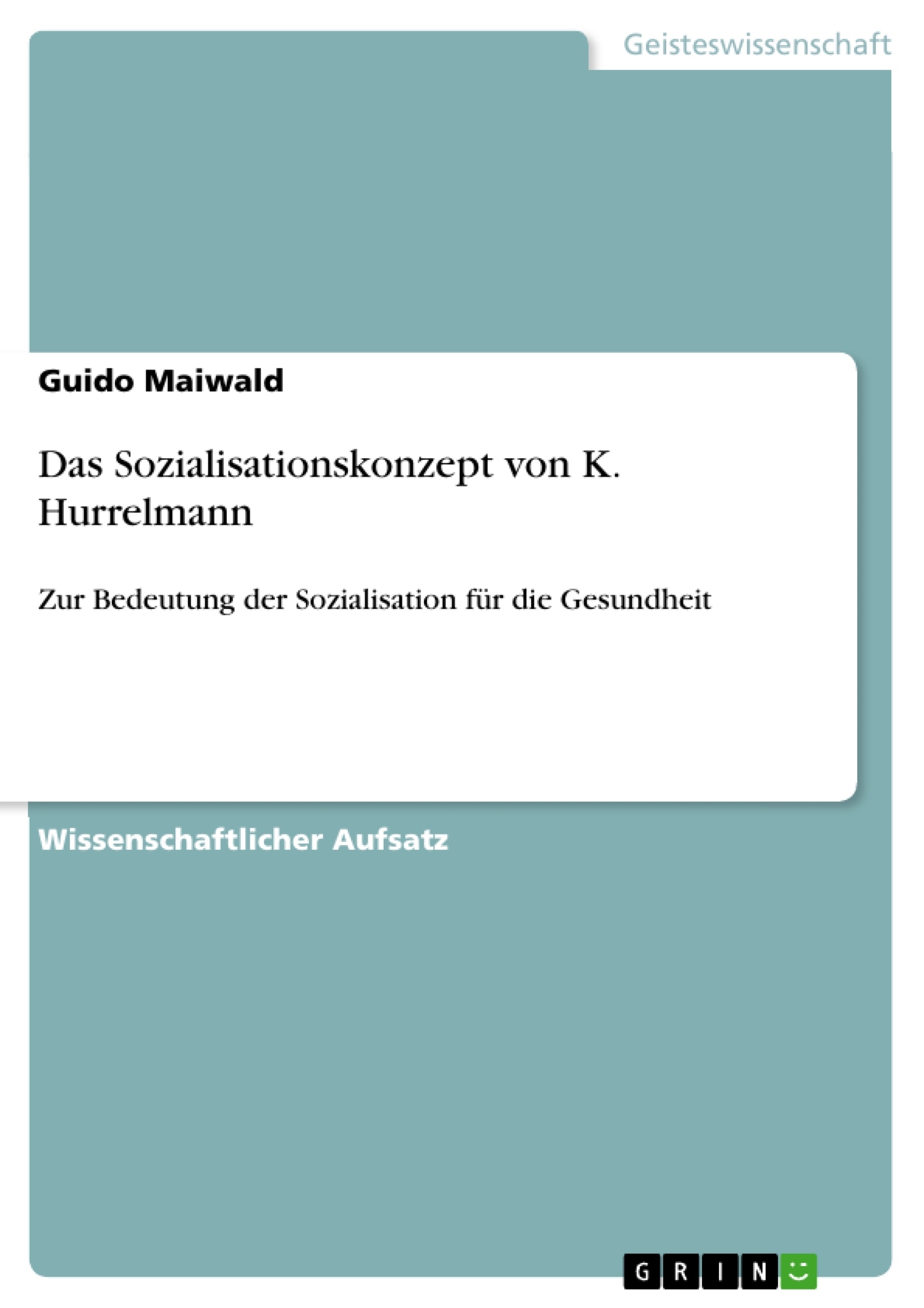Hurrelmann bezeichnet Sozialisation als „den Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit in produktiver Auseinandersetzung mit den natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen (der „inneren Realität“) und mit der sozialen und physikalischen Umwelt“ (Hurrelmann, 2002, S. 7).
Die Gesundheitssoziologie ist eng verbunden mit dem Belastungs-Bewältigungsmodell welches die Bedingungen und Folgen gelungener oder nicht gelungener „Bewältigungen von Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf“ fokussiert (Hurrelmann, 2002, S. 269). Nach diesem Modell befindet sich der Mensch in einer ständigen Phase der Anpassung zwischen innerer (z.B. Temperament, Lernbereit-schaft) und äußerer Lebenswelt. Somit ist Persönlichkeitsentwicklung die „ständige Abstimmung zwischen den eigenen körperlichen und psychischen Bedürfnissen und Möglichkeiten und den Vorgaben und Angeboten der sozialen und materiellen Umwelt (Hurrelmann, 2000, S. 61). Sozialisation wird verstanden als Prozess permanenter Bewältigung, welche wiederum als Voraussetzung für eine produktive Verarbeitung von Belastungen und Anforderungen angesehen wird. In dieser Arbeit soll gezeigt werden welche Faktoren als Urheber eines Gesundheitszustandes von Bedeutung sind und wodurch diese beeinflusst werden. Anhand des Fallbeispiels der Lebensphase Pubertät werden mögliche Krankheitssymptome und in der Zusammenfassung mögliche Präventionsstrategien aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Das Belastungs-Bewältigungs-Modell
2. Krankheitsentwicklungen nach Altersgruppen
2.1 Krankheiten im Kindesalter
2.1.1 Erkrankungen mit psychischen oder psychosomatischen Komponenten
2.1.2 Hintergründe und Ursachen kindlicher Gesundheitsprobleme
2.2 Gesundheitsstörungen im Erwachsenenalter
2.2.1 Geschlechtsspezifisches Gesundheitsverhalten
2.2.2 Gesundheitsstörungen und Krankheiten im Alter
2.2.3 Auswirkungen von Arbeitsbedingungen auf die Gesundheit
2.2.4 Gesundheitsrisiken durch Arbeitslosigkeit
2.2.5 Gesundheitsrisiken durch Armut
2.2.6 Migration und Gesundheit
2.2.7 Der Einfluss der Lebensform auf die Gesundheit
3. Lebensübergänge als Stressfaktoren und Gesundheitsrisiko
3.1 Exemplarbeispiel Pubertät
Zusammenfassung
Literatur