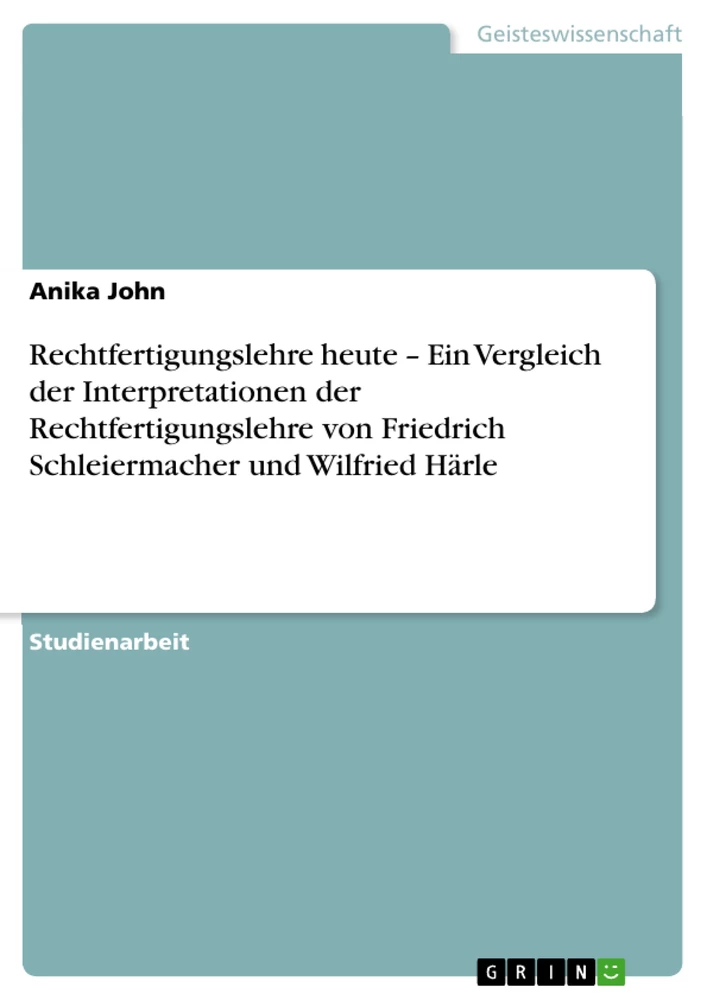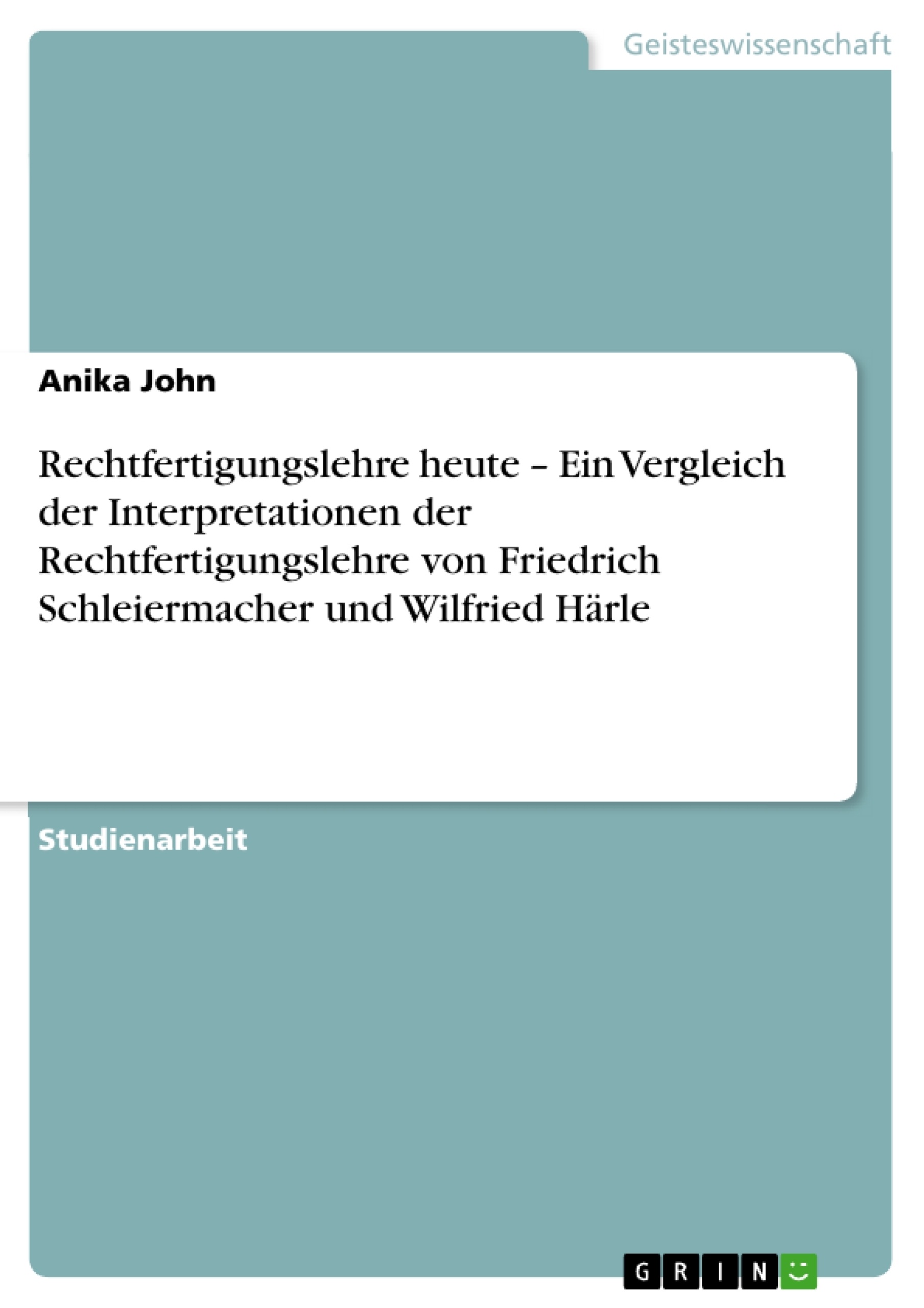„Articulus iustificationis est magister et princeps, dominus, rector et iudex super omnia genera doctrinarum“ – Der Artikel von der Rechtfertigung ist der Lehrer und Fürst, Herr, Leiter und Richter über alle Arten von Lehren. Mit dieser Aussage bekräftigte Luther die hohe Bedeutung des Rechtfertigungslehre und ihre vorrangige Stellung vor allen Lehren.
Bis heute gilt sie für die Lutheraner als die wichtigste Glaubenslehre überhaupt. Doch hat sich ihre Botschaft auch nach der Zeit Luthers bis in die heutige Welt hinein bewahrt und ist sie den Menschen zugänglich? Wie wird die Rechtfertigungslehre heute verstanden und interpretiert?
Auf die wichtige Frage nach der Interpretation der Rechtfertigungslehre in der Ge-genwart möchte ich in dieser Ausarbeitung eingehen. Dabei werden mir hierzu die Ausführungen und Gedanken zweier Theologen zu Grunde liegen: Friedrich Schlei-ermacher und Wilfried Härle. Anhand ihrer Ausführungen zur Rechtfertigungslehre möchte ich zwei verschiedene Interpretationen heutiger Zeit vorstellen und vergleichend analysieren.
Dabei werde ich zuerst auf die hierzu ausgewählten Texte der Autoren, die mir als Quellen vorliegen, eingehen und sie in ihrem historischen und theologischen Kontext einordnen. Darauf folgt die Vorstellung der Kernaussagen der jeweiligen Texte besonders in Bezug auf ihren Gehalt und ihre Interpretation zur Rechtfertigungslehre. Schließlich wird der Hauptteil mit einer vergleichenden Darstellung der jeweiligen Interpretationen der Autoren abschließen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. ZUR QUELLENLAGE
3. INTERPRETATIONEN DER RECHTFERTIGUNGSLEHRE
3.1 DIE INTERPRETATION VON SCHLEIERMACHER
3.2 DIE INTERPRETATION VON HÄRLE
4. VERGLEICHENDE ANALYSE
5. SCHLUSSBEMERKUNGEN
LITERATURVERZEICHNIS