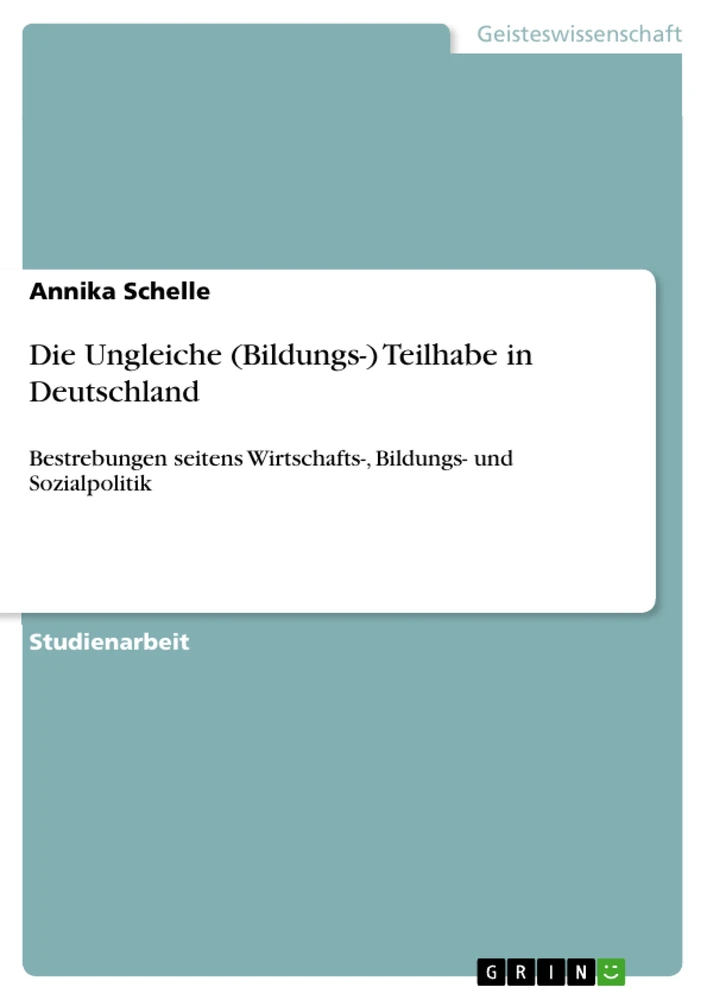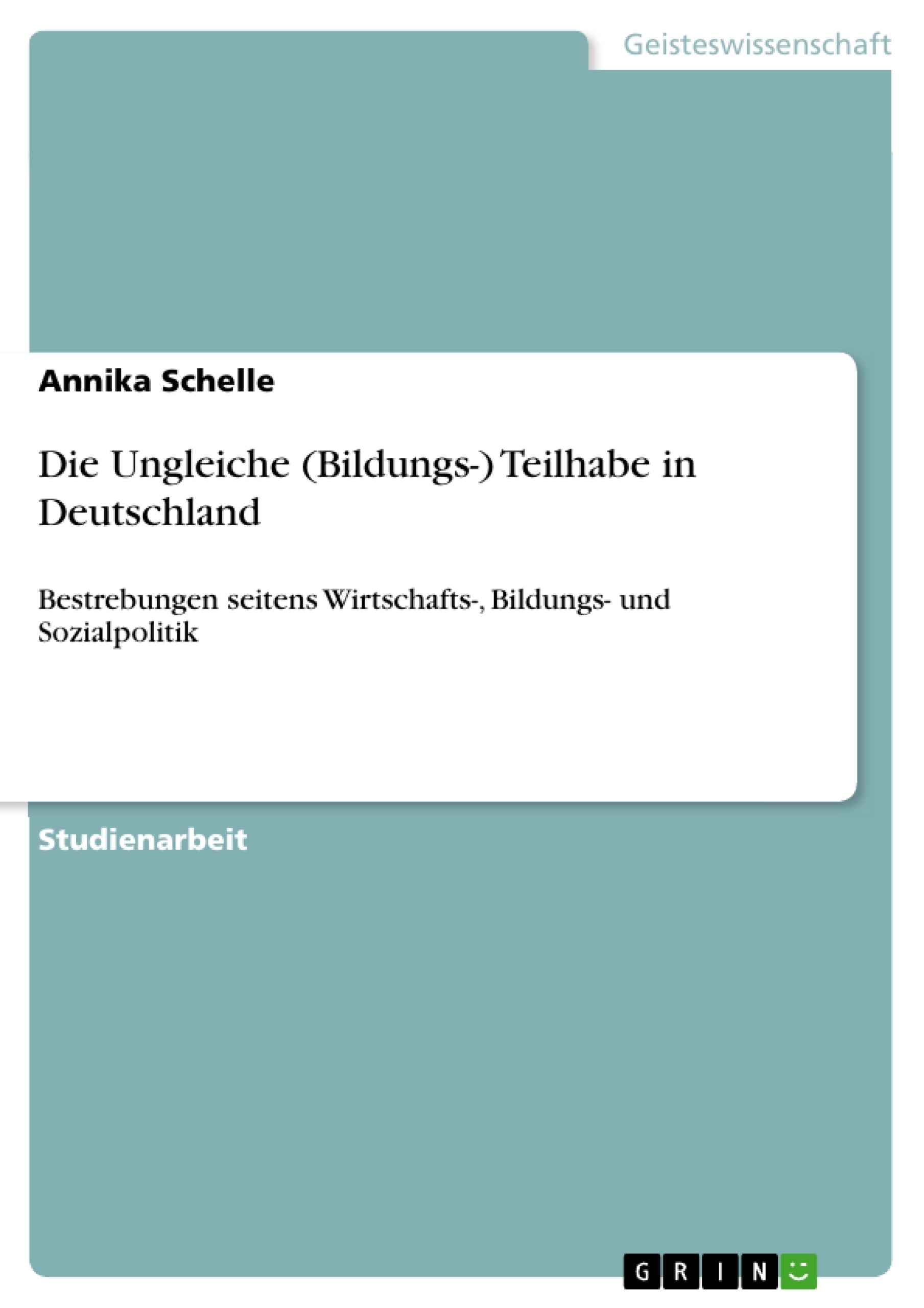Wir befinden uns gegenwärtig in der Übergangsphase von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft, in dem die Bedeutung von Arbeit und Kapital sinkt und das kulturelle Kapital, Wissen, zusehends wichtiger wird. Hier dient die Globalisierung als Motor zur Produktion von Wissen, nur durch Wissen kann Deutschland auf den Weltmärkten wettbewerbsfähig bleiben. In diesem Zusammenhang sind die Ergebnisse der Vergleichsstudien von PISA u.w. umso problematischer, jene zeigten erhebliche Defizite in der Konkurrenzfähigkeit des Bildungssystems, u.a. in Deutschland, auf. Nun wird seitens der Wirtschafts- und Bildungspolitik eine Reformierung des Bildungssystems gefordert, die die Qualität von Bildung verbessere und bereits deutlich früher als bislang ansetzen sollte. Diesbezüglich ist die ungleiche Bildungsteilhabe in Deutschland ein schwerwiegendes Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ebenda versucht derzeitig die Sozialpolitik, durch AGENDA 2010, den Problematiken des Landes entgegen zu wirken.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf die zuvor geschilderte Problematik. Sie geht der Frage nach, wie die ungleiche (Bildungs-) Teilhabe seitens Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik erfasst und gelöst werden könnte. Es stellen sich Frage wie: Was bedeutet soziale Ungleichheit und was beinhaltet die ungleiche Bildungsteilhabe? Welche Perspektiven bzw. Bestrebungen verfolgen Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftspolitik? Konnte bereits die ungleiche (Bildungs-) Teilhabe verbessert werden?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Die Ungleiche (Bildungs-) Teilhabe in Deutschland Bestrebungen seitens Wirtschafts-, Bildungs- und Sozialpolitik
2.1 Die Soziale Ungleichheit
2.2 Die Ungleiche Bildungsteilhabe
3. Perspektiven
3.1 Bildungsökonomie
3.2 Sozialpolitik
4 Fazit
Literaturverzeichnis