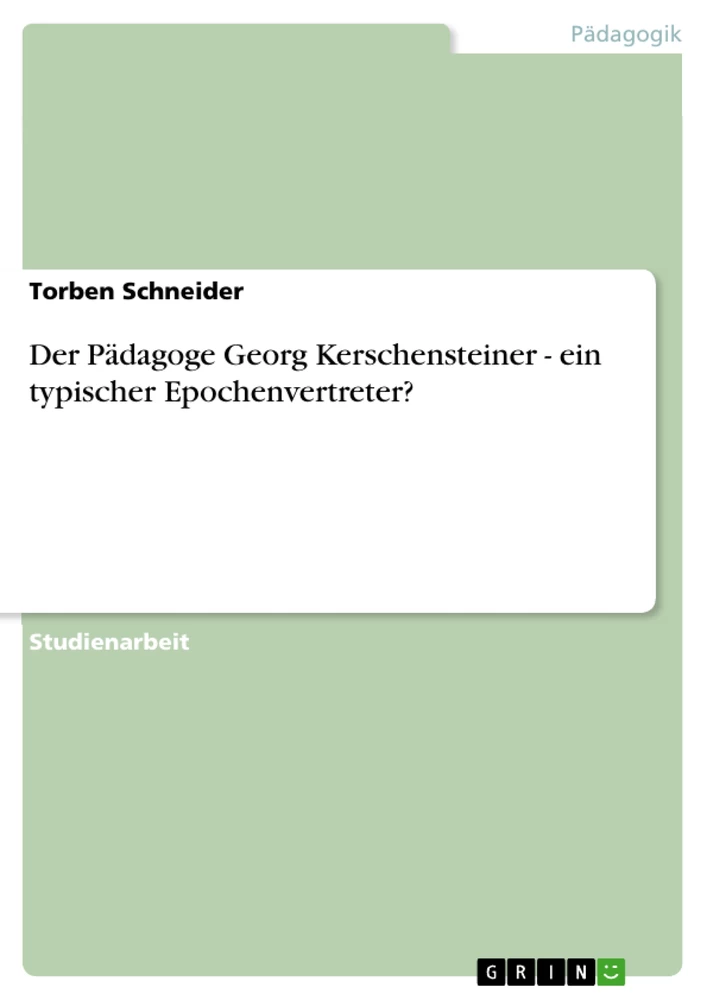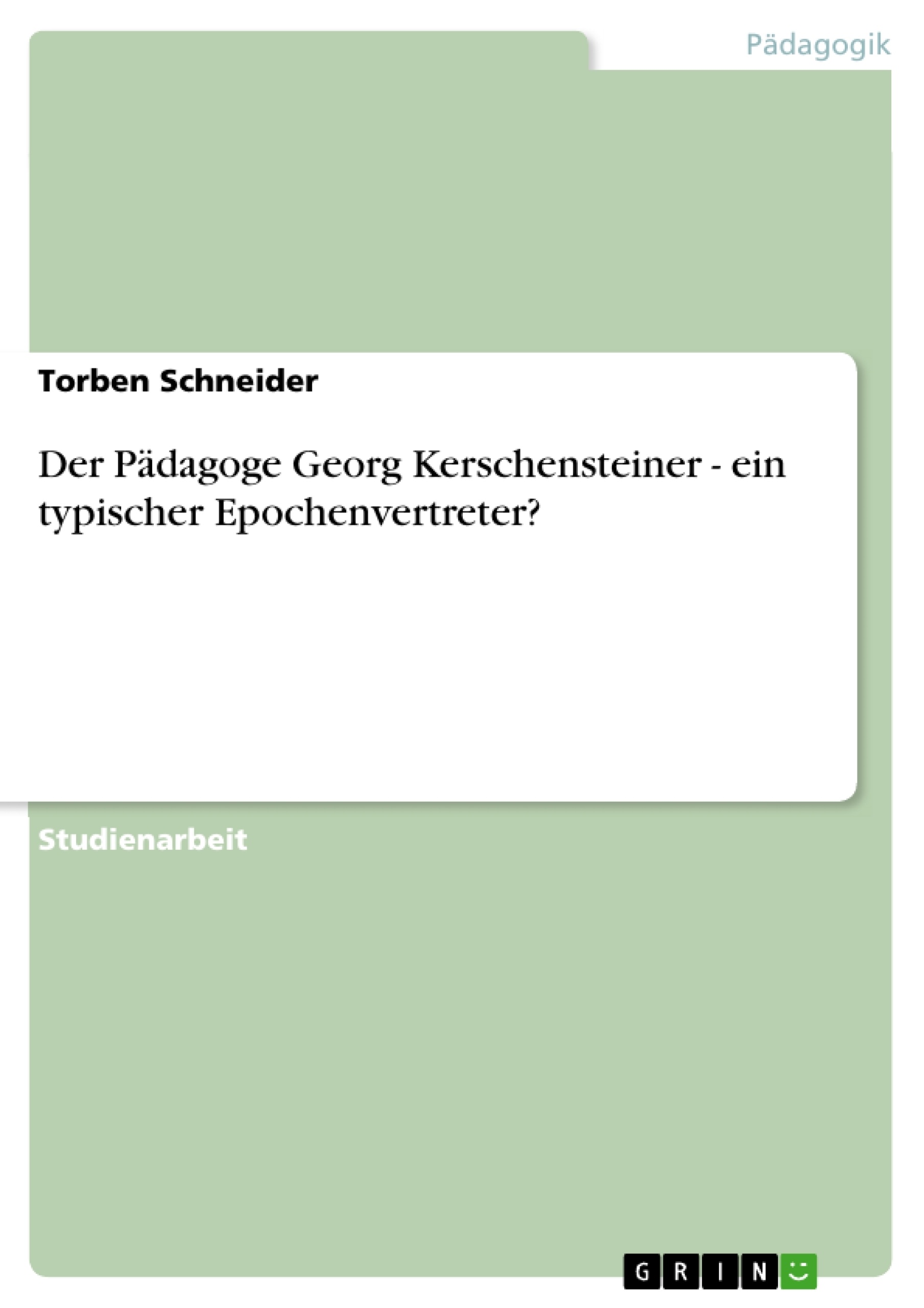In der folgenden Arbeit möchte ich mich mit Georg Kerschensteiner beschäftigen, der als „Vater der Berufsschule“ (Gudjons 1997, S.101) gilt. Als Student der Wirtschaftspädagogik liegt mein Interesse besonders in diesem Bereich, da Kerschensteiner zu Beginn des 20. Jahrhundert mit seinen Ideen eine Reformierung der damals bestehenden Fortbildungsschulen erreichte, deren Auswirkungen eine große Bedeutung für unser heutiges duales Berufsschulsystem hat.
Zunächst soll der zeitgeschichtliche Hintergrund dargestellt werden, da dieser das Denken zu jener Zeit wesentlich beeinflusste. Im Anschluss werden Kerschensteiners Theorien zur Arbeitsschule und Berufsschule dargelegt. In diesem Zusammenhang wird der Frage nachgegangen, ob Kerschensteiner als typischer Vertreter einer Epoche der Pädagogik gelten kann. Abschließend soll geklärt werden, welche seiner Ideen noch heute in unserem Bildungssystem existieren und in welcher Form sie umgesetzt werden.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Zeitgeschichtlicher Hintergrund der Reformpädagogik
2.1. Die gesellschaftliche-kulturelle Situationbr
2.2. Die schulischen Situation
3. Georg Kerschensteiner
3.1. Die Idee der Arbeitsschule
3.2. Die Idee der Berufsschule
4. Georg Kerschensteiner als typischer Epochenvertreter
5. Die Aktualität und Wirkung Georg Kerschensteiners
6. Schluss
7. Literaturverzeichnis
8. Anlage