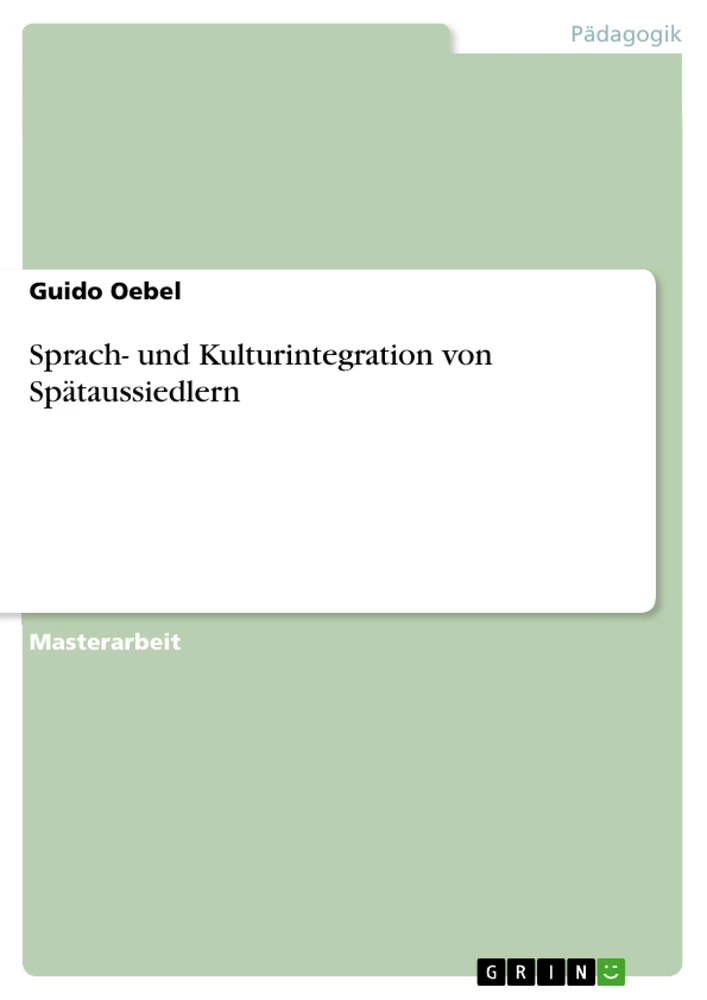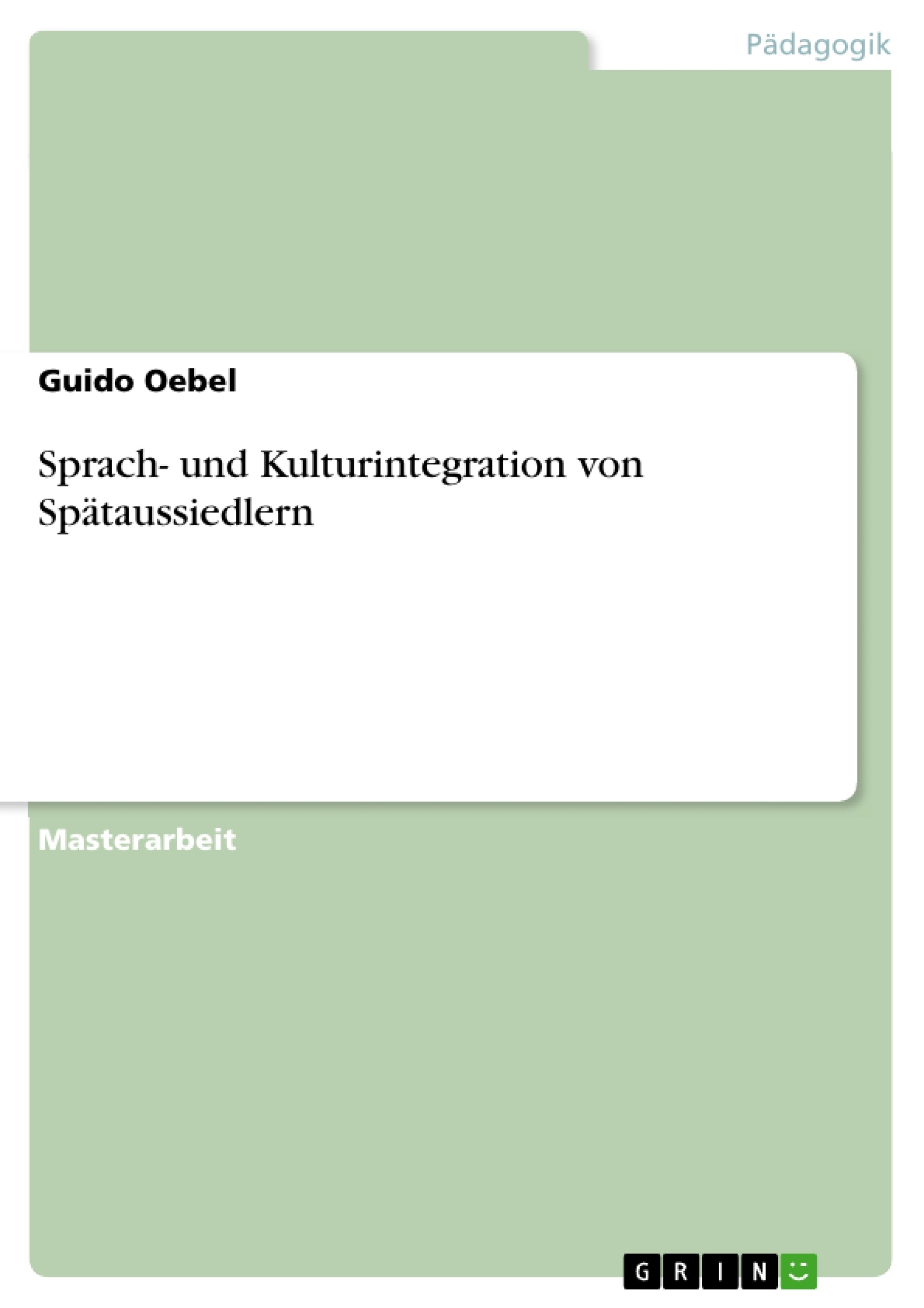Zwar galt die erste Themenpriorität einem eher sprachwissenschaftlichen Leitgedanken, aufgrund der erwachsenenpädagogisch relevanteren Aussiedlerproblematik fiel die Wahl des Thema schließlich auf die nicht ausschließlich Sprach-, sondern auch Kulturintegration von Spätaussiedlern. Obwohl ich deutscher Muttersprachler bin, habe ich über die von mir erlernten und professionell genutzten Fremdsprachen erst als ursprüngliche DaF-Vertretung zum Deutschen zurückgefunden. Da zum Zeitpunkt der Masterarbeit neben ausländischen Studenten, Asylberechtigten und Kontingentflüchtlingen überwiegend Spätaussiedler zu meinen damaligen Sprachschülern gehörten, ist mir die spezifisch methodisch-didaktische Lehr-bzw. Lernproblematik ebenso bekannt wie die Spezifität deren außerschulischer Situation. In diesem Zusammenhang soll kritisch evaluiert werden, ob – abgesehen von finanzpolitischen Zwängen - die Instrumentarien der bundesrepublikanischen Sprach- und Integrationspolitik ausreichen, um die hier untersuchte Zielgruppe an eine aktive Teilhabe an der Gesellschaft und Arbeitswelt heranzuführen.
Gliederung
II Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Themenmotivation
1.2 Begriffsdefinition 'Spätaussiedler'
1.3 Vorbetrachtung
2 Ungebrochener Zuzug von Spätaussiedlern
3 Differenzierungsmerkmale von Immigranten im allgemeinen und Spätaussiedlern im besonderen
4 Ziel der Integrationsbemühungen der Spätaussiedler
4.1 Integrationsaufgaben von Aussiedlern beim Eingliederungsprozess
4.1.1 Kognitive Ebene
4.1.2 Formale Ebene
4.1.3 Psycho-soziale Ebene
5 Schwindende Aufnahmebereitschaft
5.1 Die Situation auf dem deutschen Arbeitsmarkt
6 Unabläßliche Notwendigkeit der Sprachförderung
6.1 Sicherstellung des Lebensunterhalts während des Sprachkurses
7 Ergebnisse bzw. Empfehlungen der MAGS-Studie
7.1 Effektivität der sechsmonatigen Sprachkurse
7.1.1 Kontradiktorischer Curriculumentwurf des Goethe-Instituts
7.1.2 Forderung an Lehrkräfte und Träger
7.2 Differenzierte Sprachförderung
7.2.1 Einbeziehung berufspraktischer Anteile
7.2.2 Zusammensetzung der Sprachkurse
7.2.3 Einheitliche Curricula
7.4 Notwendigkeit breiter Spannweite bei FuU
7.4.1 Erwägung homogener FuU-Maßnahmen
8 Fazit und Prognose
9 Quellenverzeichnis
9.1 Zitierte Literatur
9.2 Zitierte Tabellen und Schaubilder