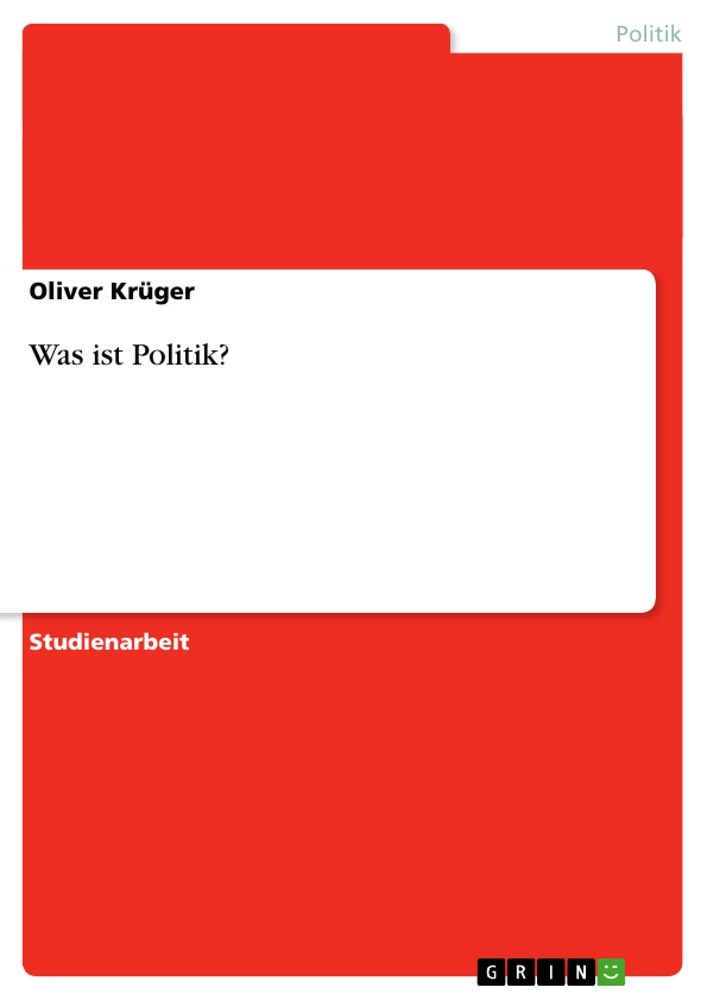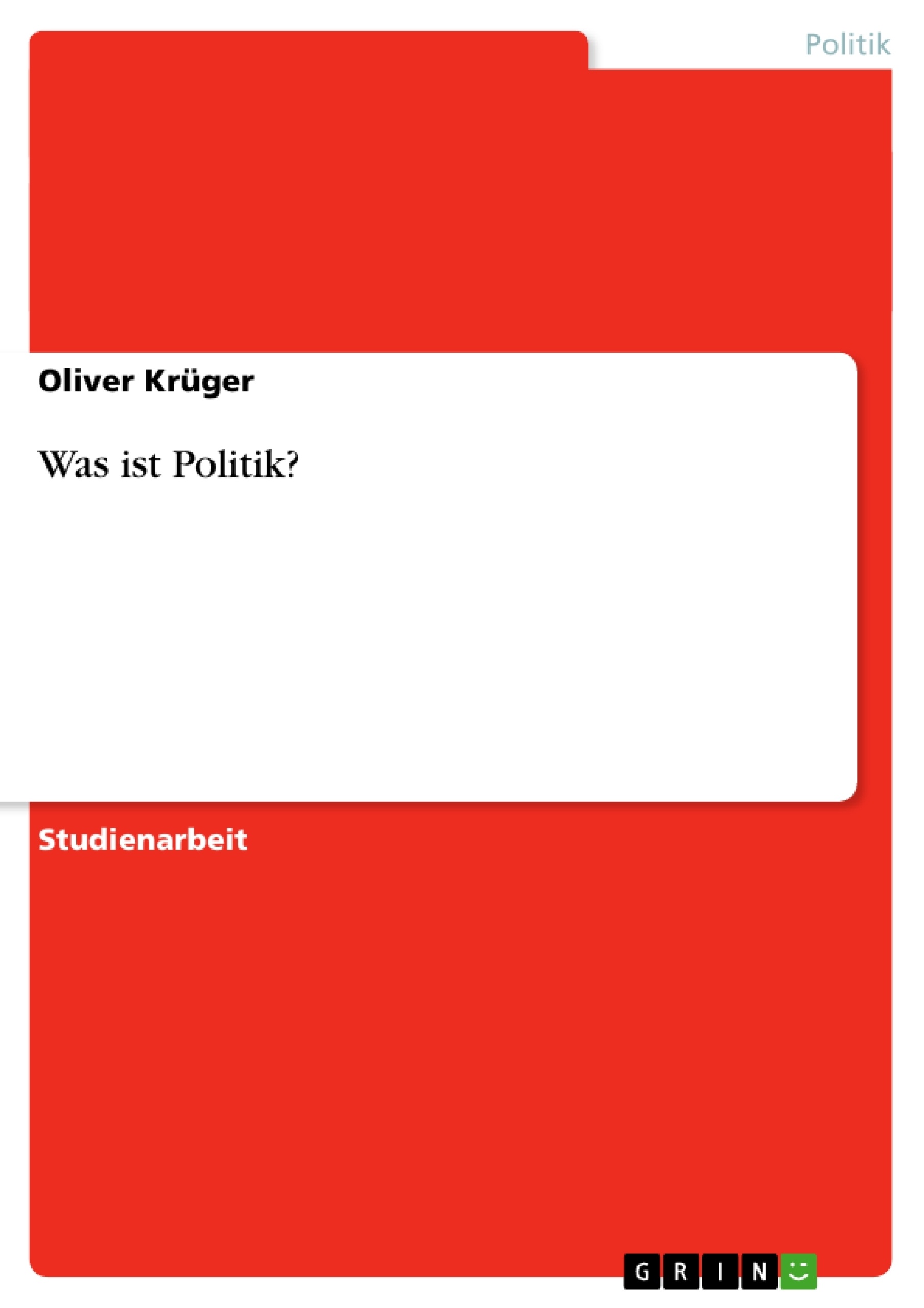"Wir wissen eigentlich nicht, was Politik ist, aber wir sehen, dass sie sich ereignet" (J. W. M. Mackenzie)
Mit diesem Zitat versuche ich das Ergebnis bei der Suche nach dem Politikbegriff schlechthin bereits an den Anfang meiner Ausführungen zu stellen. Doch alleine die Erkenntnis, dass ein Konsens nur im Dissens bestehen kann, wenn verschiedene Personen mit verschiedenen Blickwinkeln ein Problem betrachten, kann keine erschöpfende Auskunft darstellen. Es stellt sich also in erster Linie nicht die Frage nach dem richtigen Politikbegriff; vielmehr verschiebt sich die Fragestellung von dieser absoluten Definition weg und sucht statt dessen zu ergründen, wie es dazu kommen kann, dass es keine allgemeingültige und umfassende Definition von dem, was Politik ist, finden lässt.
Um die Entwicklung der verschiedenen Politikbegriffe, die unterschiedlich mit Inhalt gefüllt werden und jeweils auf eigene Weise definieren wollen was Politik ist, zu veranschaulichen, werde ich mich im ersten Teil dieser Arbeit mit der geschichtlichen Entwicklung im Denken um Politik befassen. Die zeitliche Entwicklung und die verschiedenen Epochen, die bei der Suche nach einem endgültigen Politikbegriff durchlaufen worden sind und noch durchlaufen werden, bilden somit einen Überblick über den Wandel dessen, wie Politik definiert worden ist. Es werden sich hierbei verschiedene Denkansätze herauskristallisieren, die ich in einem zweiten Schritt genauer untersuchen werde, ihre Unterschiede darstelle und versuchen möchte, die bekanntesten dieser Denkansätze miteinander zu vergleichen.
Der jeweils unterschiedliche Blickwinkel, der besondere Augenmerk, der in den unterschiedlichen Theorien auf bestimmte Aspekte des menschlichen Miteinanders gelegt wird, die Ansicht darüber, ob bei einer Definition von Politik, Macht wichtiger sei als Herrschaft oder Gewalt wichtiger als Legitimation, soll sich bei der Ausarbeitung der beiden oben genannten Punkte, von der Entwicklungsgeschichte bis zur Gegenüberstellung der „übriggebliebenen“ Theorien der Politikwissenschaftlichen Historie, als roter Faden durch meine Ausführungen ziehen.
Inhalt
0. Vorwort
1. Die geschichtliche Entwicklung des Politikbegriffes von Platon bis J.J. Rousseau
2. Die unterschiedlichen Politikverständnisse
2.1 Das Politikverständnis in der Antike
2.2 Das Politikverständnis in der Moderne
2.3 Das Politikverständnis in der Systemtheorie
3. Unterschiedliche Dimensionen der politischen Realität
4. Probleme bei der Suche nach dem Politikbegriff
4.1 Die Brauchbarkeit der unterschiedlichen Politikbegriffe
4.2 Wie sich unterschiedliche Politikbegriffe entwickelten
5. Nachwort
6. Literatur
0. Vorwort
"Wir wissen eigentlich nicht, was Politik ist, aber wir sehen, dass sie sich ereignet" (J. W. M. Mackenzie a.a.O.)
Mit diesem Zitat versuche ich das Ergebnis bei der Suche nach dem Politikbegriff schlechthin bereits an den Anfang meiner Ausführungen zu stellen. Doch alleine die Erkenntnis, dass ein Konsens nur im Dissens bestehen kann, wenn verschiedene Personen mit verschiedenen Blickwinkeln ein Problem betrachten, kann keine erschöpfende Auskunft darstellen. Es stellt sich also in erster Linie nicht die Frage nach dem richtigen Politikbegriff; vielmehr verschiebt sich die Fragestellung von dieser absoluten Definition weg und sucht stattdessen zu ergründen, wie es dazu kommen kann, dass sich keine allgemeingültige und umfassende Definition von dem, was Politik ist, finden lässt.
Um die Entwicklung der verschiedenen Politikbegriffe, die unterschiedlich mit Inhalt gefüllt werden und jeweils auf eigene Weise definieren wollen was Politik ist, zu veranschaulichen, werde ich mich im ersten Teil dieser Arbeit mit der geschichtlichen Entwicklung im Denken um Politik befassen. Die zeitliche Entwicklung und die verschiedenen Epochen, die bei der Suche nach einem endgültigen Politikbegriff durchlaufen worden sind und noch durchlaufen werden, bilden somit einen Überblick über den Wandel dessen, wie Politik definiert worden ist. Es werden sich hierbei verschiedene Denkansätze herauskristallisieren, die ich in einem zweiten Schritt genauer untersuchen werde, ihre Unterschiede darstelle und versuchen möchte, die bekanntesten dieser Denkansätze miteinander zu vergleichen.
Der jeweils unterschiedliche Blickwinkel, das besondere Augenmerk, das in den unterschiedlichen Theorien auf bestimmte Aspekte des menschlichen Miteinanders gelegt wird, die Ansicht darüber, ob bei einer Definition von Politik, Macht wichtiger sei als Herrschaft oder Gewalt wichtiger als Legitimation, soll sich bei der Ausarbeitung der beiden oben genannten Punkte, von der Entwicklungsgeschichte bis zur Gegenüberstellung der „übriggebliebenen“ Theorien der politikwissenschaftlichen Historie, als roter Faden durch meine Ausführungen ziehen.
1. Die geschichtliche Entwicklung des Politikbegriffes von Platon bis J.J.
Rousseau
Berg-Schlosser und Stammen weisen im Einführungsteil unter Punkt zwei ihres Buches darauf hin, dass die Politikwissenschaft und somit das systematische Denken um Politik sowohl eine alte, als auch eine neue Wissenschaft zugleich sei.[1]
Man kann die Politikwissenschaft jedoch nicht wie eine Naturwissenschaft behandeln, bei der die Endergebnisse aktueller Forschung vorhergehende Irrtümer überflüssig machen. Vielmehr interessiert gerade der Weg, der zu den jeweiligen Ergebnissen in der Politikforschung führte und nicht ausschließlich die Antwort, die auf die Problemstellung folgt. Die Forschung im Bereich der Politik ist somit eine Forschung, die nicht wie die Informatik nur richtig oder falsch kennt. Wie bereits im Vorwort erklärt, ist die Frage nach dem Politikbegriff eine Frage nach den Prozessen in der Entstehung von unterschiedlichen Politikverständnissen. Der wissenschafts-geschichtliche Hintergrund ist unentbehrlich zum Verständnis aktueller Politikdefinitionen und ihrer Voraussetzungen, da sie die Folge einer Entwicklung innerhalb der Forschungsgeschichte darstellt.
Diese Entwicklung in der Forschungsgeschichte darf nach Alemann nicht als ein kontinuierlicher Prozess verstanden werden, in dem additiv Wissen angehäuft wird und stets auf vorhandenes Wissen aufgebaut wird.[2]
Brüche und Sprünge zeichnen die Entwicklung einer Geschichte, die allgemein hin ihren Ursprung in der griechischen Antike aufweist.
Warum alt und neu zugleich ergibt sich aus der Geschichte: Die Wurzel in der Frage nach Politik, liegt in Griechenland bei Platon und Aristoteles begründet, wo sie von Aristoteles als die Königswissenschaft die, episteme kyriotata, bezeichnet wurde.[3]
Neu andererseits ist die Institutionalisierung als Sozialwissenschaft im 19. und 20. Jhd. mit der politisches Denken eine neue Qualität erreichte und sich endgültig löste von der strikten Eingebundenheit in die Philosophie und von da an einen eigenständigen Forschungszweig darstellte, der sich an Kriterien der quantitativen und qualitativen Forschung, sowie anderen naturwissenschaftsspezifischen Charakteristika wie z.B. der intersubjektiven Überprüfbarkeit, hielt.[4]
Aufgrund dieser Zweiteilung in der Entwicklungsgeschichte der Politik zwischen der „Vorgeschichte“ und der Neubegründung als Sozialwissenschaft gibt es Differenzen innerhalb der Forschung über den Beginn, den man in der wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung setzen soll. Auf der einen Seite gilt die „Vorgeschichte“ auch als vorwissenschaftlich, da ihr zum Großteil die Wissenschaftlichkeit abgesprochen wird. Mit dieser Vorgeschichte sind Autoren wie beispielsweise Homer und Hesiod gemeint. Das Nachdenken über Politik gilt innerhalb dieser Ansicht nicht automatisch als Wissenschaft, wenn nicht Kriterien der Wissenschaftlichkeit bei diesem Nachdenken beachtet werden. Der Beginn der Politikwissenschaft wird somit erst im 19./20. Jh. gesetzt.
Auf der anderen Seite steht die Ansicht, dass Platon der Begründer der Politikwissenschaft sei und alles, was nach ihm kam, nur eine „Fußnote zu Platon ist“.[5]
Platon wurde 427 v.Chr. in Athen geboren und starb 377 v.Chr. in Athen. Er war Schüler des Sokrates und Lehrer von Aristoteles.[6] In seinen Geschichten spielt oft Sokrates, der selbst keine Schriften hinterlassen hatte, da er annahm, dass er nichts wisse, was er weitergeben könnte, eine wichtige Rolle. Platons wichtigstes Werk für die Politikwissenschaft ist die Politeia.
In ihr wird die Verbindung zwischen der Formung des Geistes und der Verantwortlichkeit des Staats deutlich. Das Werk der Politeia wurde in Anbetracht der griechischen Stadtstaaten seit dem 5. Jh. v. Chr. geschrieben. Der Begriff „Politik“ geht in Rückgriff auf diese Wurzeln auf den griechischen Ausdruck „politikos“ zurück, was heißt: das Gemeinwesen betreffend. Platon stellt in der Politeia die Frage nach der besten Verfassung der Stadtstaaten, in denen die Entwicklung des Menschen in optimaler Weise gewährleistet werden kann.[7]
Das Bild des Idealstaates, das Platon in der Politeia entwirft, ist in drei Klassen von Bürgern eingeteilt: in Landwirte (sie sind das breite Volk), in Wächter (sie sichern die äußere und innere Sicherheit) und Philosophen, die in diesem Staat die Führung übernehmen. Um eine optimale Erziehung der Bürger und Staatsführung zu gewährleisten, dürfen sowohl die Wächter, als auch die Philosophen keine Familie und keine Eigentümer besitzen; somit soll gewährleistet sein, dass ihr Hauptaugenmerk der Durchführung ihrer zugeteilten Aufgaben gilt.[8]
Die Grundlage für eine derartige Staatstheorie liegt in der Annahme, dass die Bürger in einem Staat der besonderen Führung einer Obhut benötigen, die sie in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer individuellen Fähigkeiten unterstützt und ihnen subsidiär hilft. Aus dieser Annahme ergibt sich die Form von Staat, die sich in der Bürgerschaft sowie deren Verfassung (politeia) in Platons Staatslehre manifestiert. Platons Politeia ist somit durchdrungen von philosophischen Moralvorstellungen.
Platons Schüler, Aristoteles wurde 384 v.Chr. in Stageira (Thrakien) geboren und starb 322 v.Chr. in Chalkis.[9] Im Gegensatz zu Platon, der in diesem Punkt gänzlich seinem Lehrer Sokrates folgte, stützen sich die Überlegungen von Aristoteles auch auf empirische Verfahrensweisen. Bei Aristoteles wenden sich die Überlegungen über die Politik gegen einseitige Entwürfe, die politische Systeme als Resultat von Überlegungen über Moralfragen bedingen. Moral und Ethik sind jedoch nicht bei der Frage nach dem idealen Staat zu vernachlässigen und so ergibt sich ein symbiotisches Verhältnis zwischen Ethik und Politik. Besonders deutlich wird dies in den Werken Aristoteles´ „Nikomachische Ethik“ und „Politik“.[10]
Nach Aristoteles gibt es einen Bruch in der Kontinuität der Entwicklung der Politik und des Politikverständnisses, in der Form, dass etwa 200 Jahre kein bedeutender Philosoph auf diesem Gebiet in Erscheinung getreten ist. Bedingt ist dies durch die Unterwerfung Griechenlands, das damals die in philosophischen Fragen am weitesten fortgeschrittene Kultur beherbergte, durch Alexander den Großen und anschließend durch das Römische Reich. Der römische Autor Marcus Tullius Cicero ist der Autor, mit dem die Entwicklung weitergeht. Er wurde am 3. 1. 106 v. Chr. In Arpinum geboren und starb am 7. 12. 43 v. Chr. bei Formiae.[11] Cicero verfolgte dieselbe Konzeption wie Aristoteles und eignete sich seine und die Ideen von Sokrates und Platon an. Er war ein großer Bewunderer der griechischen Philosophie und blieb einzig bedeutender römischer Autor über Politik. Auch er verfolgte die Idee der Zeitkritik in Verbindung mit der praktischen Philosophie. Während Platon und Aristoteles in Anbetracht der Polis, der griechischen Stadtstaaten und deren Eigenarten ihre Politikstudien betrieben, betrachtete Cicero die Entwicklung des Römischen Reiches.
[...]
[1] Vgl. Berg-Schlosser, Dirk / Theo Stammen „Einführung in die Politikwissenschaft“ 6. Auflage, München 1995, S. 2 f
[2] vgl. Von Alemann, Ulrich: Grundlagen der Politikwissenschaft. Ein Wegweiser, Opladen 1994 S. 22
[3] Vgl. von Alemann, a.a.O. S. 7
[4] vgl. von Alemann, a.a.O. S. 22
[5] Von Alemann, a.a.O. S. 22
[6] vgl. www.wissen.de
[7] vgl. Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon der Politik, Bd. 7: Politische Begriffe, München 1998, S. 408; vgl. Schlosser / Stammen, a.a.O. S. 7
[8] vgl. Alemann, a.a.O. S. 23
[9] vgl. www.wissen.de
[10] vgl. Berg-Schloser / Stammen, a.a.O. S. 7
[11] vgl. www.wissen.de