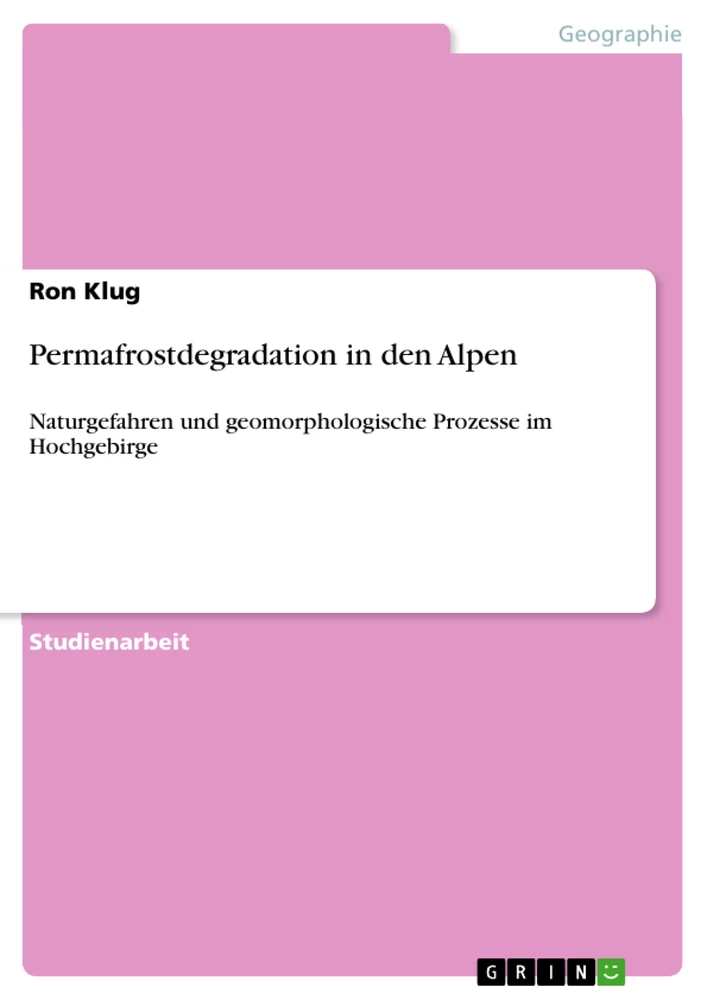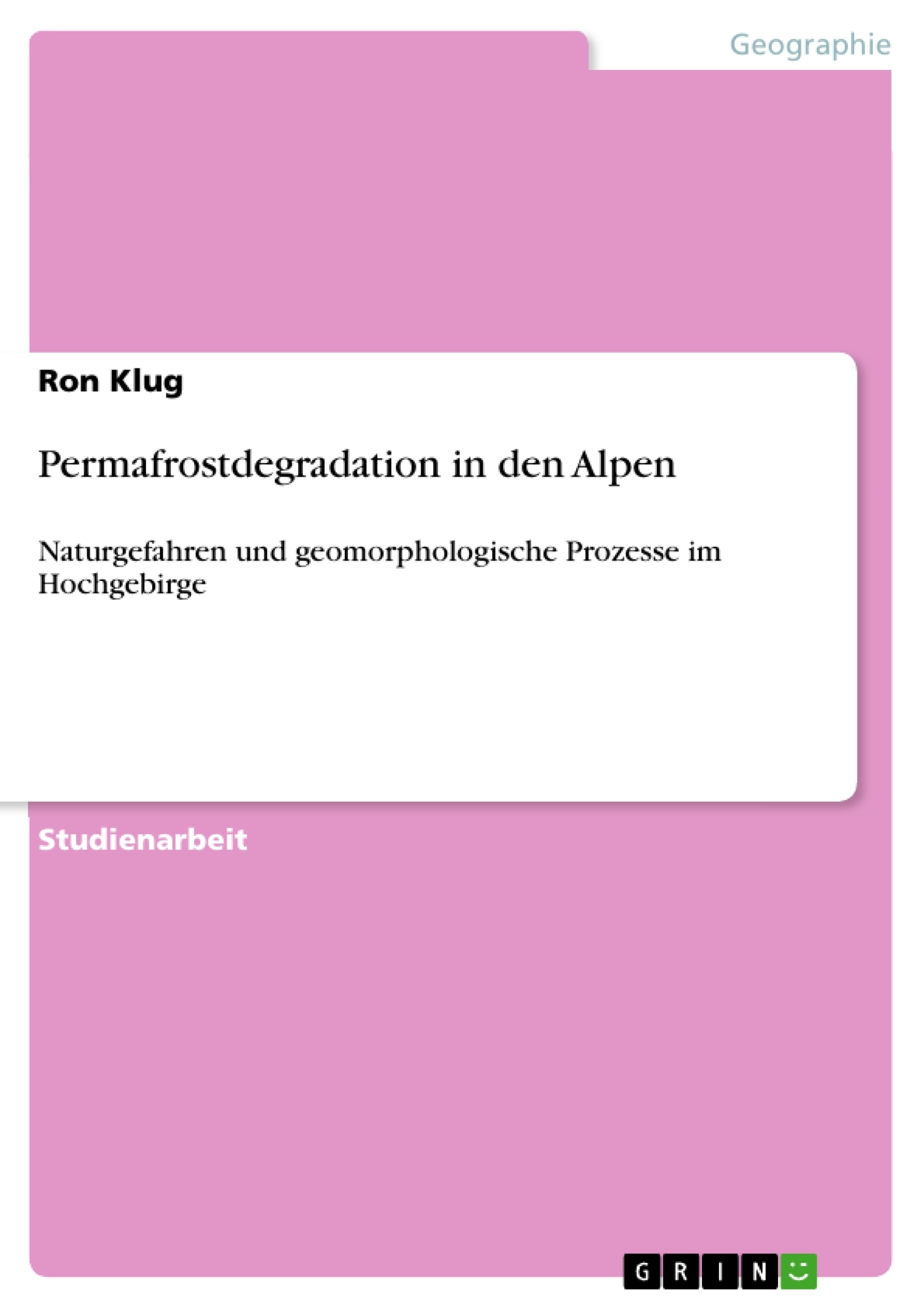Permafrost bedingt in den Alpen bereits ab Höhen über 2.000 m eine wesentliche Stabilisierungsfunktion. Sowohl aus Lockermaterial bestehende Berghänge als auch geklüftete Felswände werden durch Permafrost zusammengehalten. Der globale Klimawandel führt jedoch auch im Alpenraum zu veränderten klimatischen Bedingungen mit der Folge, dass sich die Untergrenze der Permafrostverbreitung bis heute bereits um mehrere 100 m erhöht hat. Der Anstieg der Permafrostgrenze führt zu einer eigenen Dynamik geomorphologischer Formen und Prozesse in der alpinen Eiswelt.
Die Stabilität der gefrorenen Berge in den Alpen scheint immer mehr aus dem Gleichgewicht zu geraten und birgt somit ein erhöhtes Gefahren- und Risikopotential in sich. Die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Massenbewegungen steigt und damit auch die Gefährdung von Menschen und infrastrukturellen Einrichtungen.
Die Forschung zur Permafrostdegradation ist allerdings eine noch sehr junge Disziplin. Zwar beschäftigten sich russische und amerikanische Forscher schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit Permafrost, doch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
den Ursachen, Prozessen und Folgen der Permafrostdegradation erfolgt erst seit den 1970er Jahren (vgl. FRENCH 1996, S. 51 f.). Seitdem gab es zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, um die Verbreitung von Permafrost, insbesondere in Form von
Blockgletschern, zu verstehen und mögliche Auswirkungen der Klimaerwärmung abschätzbar zu machen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Betrachtungsraum
3 Permafrost - Grundlagen
3.1 Begriffsbestimmung
3.1.1 Permafrost
3.1.2 Degradation
3.2 Differenzierungen
3.3 Aufbau
3.4 Verteilungsmuster
3.5 Verbreitungsfaktoren
4 Vorkommen von Permafrost
4.1 Global
4.2 Schweiz
4.3 Oberengadin
4.4 Anzeiger
4.4.1 Schneeflecken
4.4.2 Blockgletscher
5 Degradation
5.1 Ursachen
5.2 Auswirkungen
5.3 Messmethoden
5.3.1 Extensometer (mechanisch)
5.3.2 Bohrloch (thermisch)
5.3.3 Geoelektrik (elektrisch)
6 Folgen
6.1 Massenbewegungen
6.1.1 Steinschlag
6.1.2 Felssturz
6.1.3 Bergsturz
6.1.4 Mure
6.2 Infrastruktur
6.2.1 Gipfelbauten
6.2.2 Lawinenverbauungen
7 Gegenmaßnahmen
7.1 Pontresina
7.2 Erzherzog-Johann-Hütte
8 Schlussbemerkung
9 Literaturverzeichnis