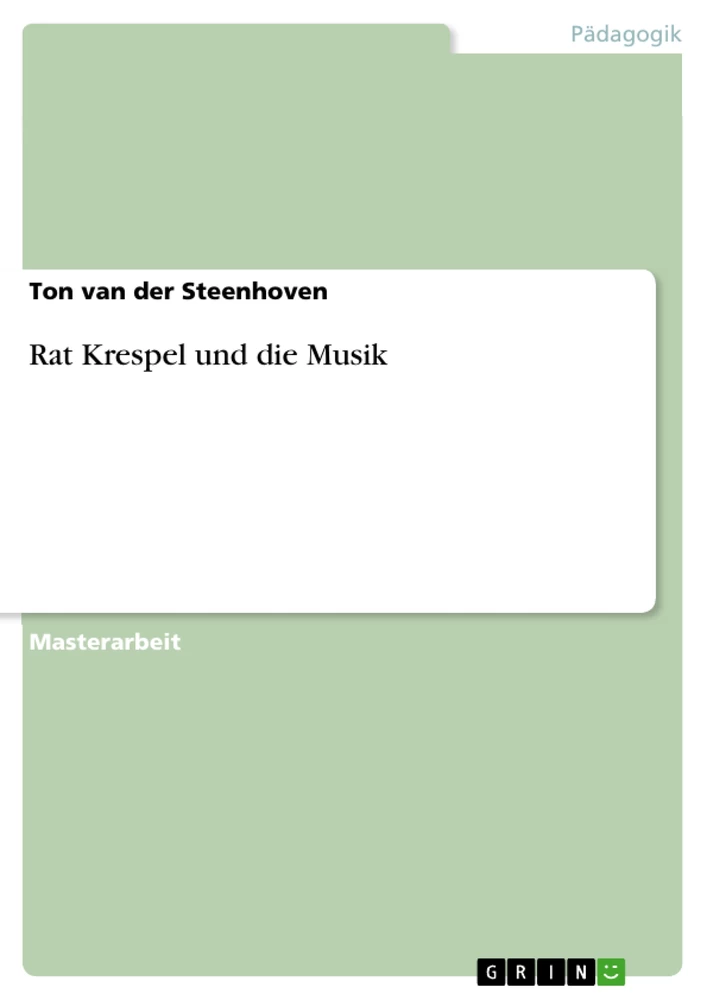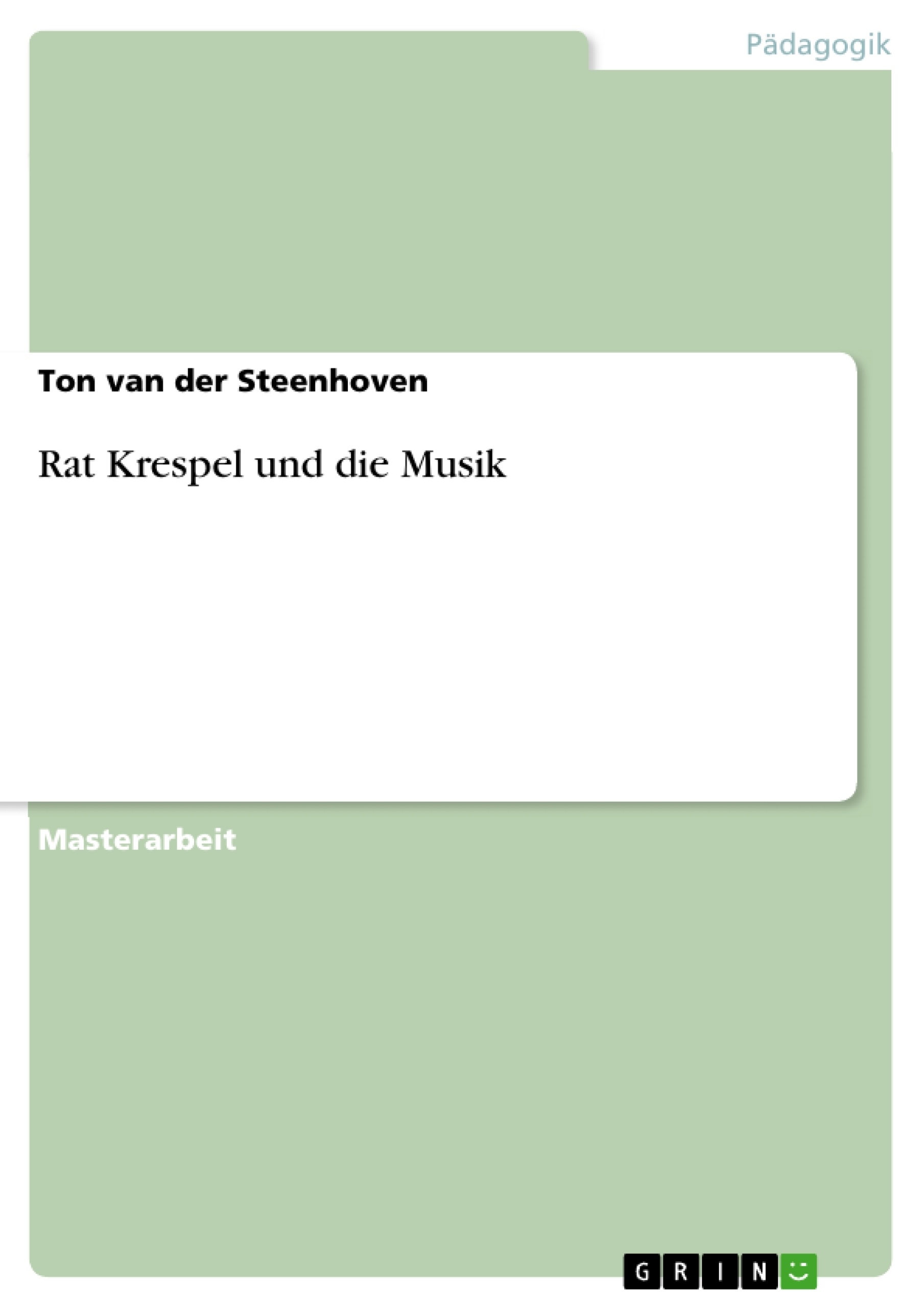E.T.A. Hoffmanns Geschichte “Rat Krespel” wird nicht nur analysiert, sondern auch in der Kontext der musikalischen Praxis Anfang 19. Jh. besprochen. Siehe die Kapitel “Die Musik in der Romantik” und “Die Frau in der Musik des 19. Jahrhunderts”.
Der Satz “...dessen innere Einrichtung aber eine ganz eigene Wohlbehaglichkeit erregte”, in der Geschichte, ist ein Schlüsselsatz: Er deutet auf die für Krespel sehr wichtigen Unterschied zwischen dem Innen- und Außenraum. Das Haus symbolisiert den Innenraum. Im Innenraum ist Krespel allmächtig: Antonie ist ihm untergeordnet, Menschen, die ihm nicht gefallen, kann er wegschicken und er stillt seinen Neugier auf das Geheimnis der Musik mit der Zerlegung alter Geigen und mit dem Geigenbau.
In der Analyse werden Krespel und der Ich-Erzähler in Bezug auf ihr Verhältnis zu Antonie einander gegenüber gestellt. In der Gestalt Antoniens spiegelt sich eine romantische Auffassung der Kunst: Der Zusammenhang zwischen Kunst und Verfall, Schönheit und Krankheit.
Inhalt
Einleitung
Hoffmanns Blick auf die Welt
Die Serapionsbrüder
Die Erzählung
Krespel und der Ich-Erzähler
Antonie und ihre Geige
Die Musik in der Romantik
Klassik versus Romantik in der Musik in Stichwörtern
Die Frau in der Musik des 19. Jahrhunderts
Schlussfolgerung
Literatur