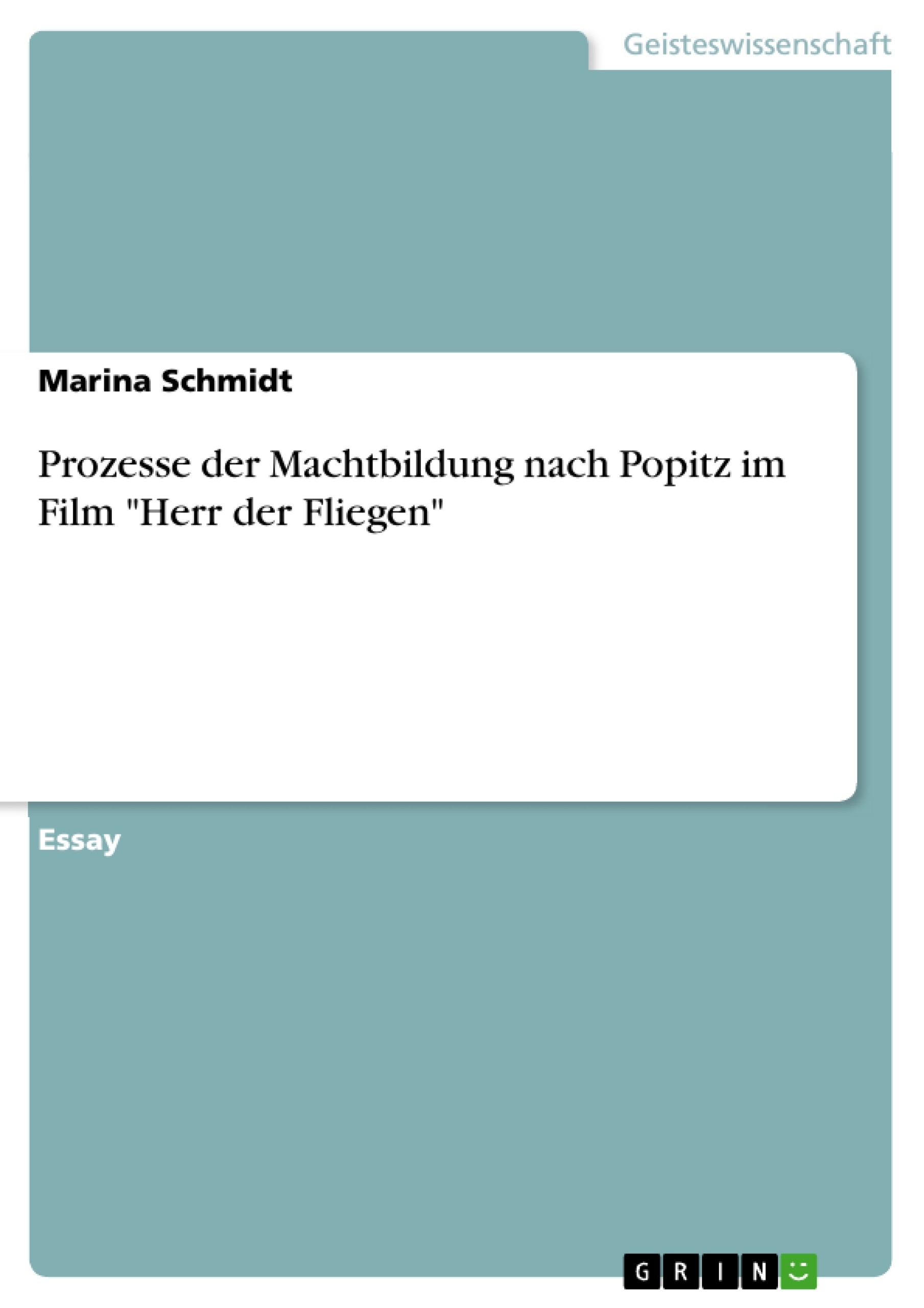In diesem Essay soll versucht werden, die in dem Film „Herr der Fliegen“ (1963) dargestellten Verhaltensweisen der Protagonisten mit Hilfe der Arbeiten von Heinrich Popitz, hier besonders „Die normative Konstruktion von Gesellschaft “ sowie „Prozesse der Machtbildung “, in einen Deutungszusammenhang zu bringen. Im Folgenden soll die Handlung des Films chronologisch abgearbeitet werden, um Schritte im Prozess der Machtbildung nachzuvollziehen sowie abschließend auf die Thematik „abweichendes Verhalten“ im Rahmen des Films zu sprechen zu kommen.
Prozesse der Machtbildung nach Popitz im Film "Herr der Fliegen"
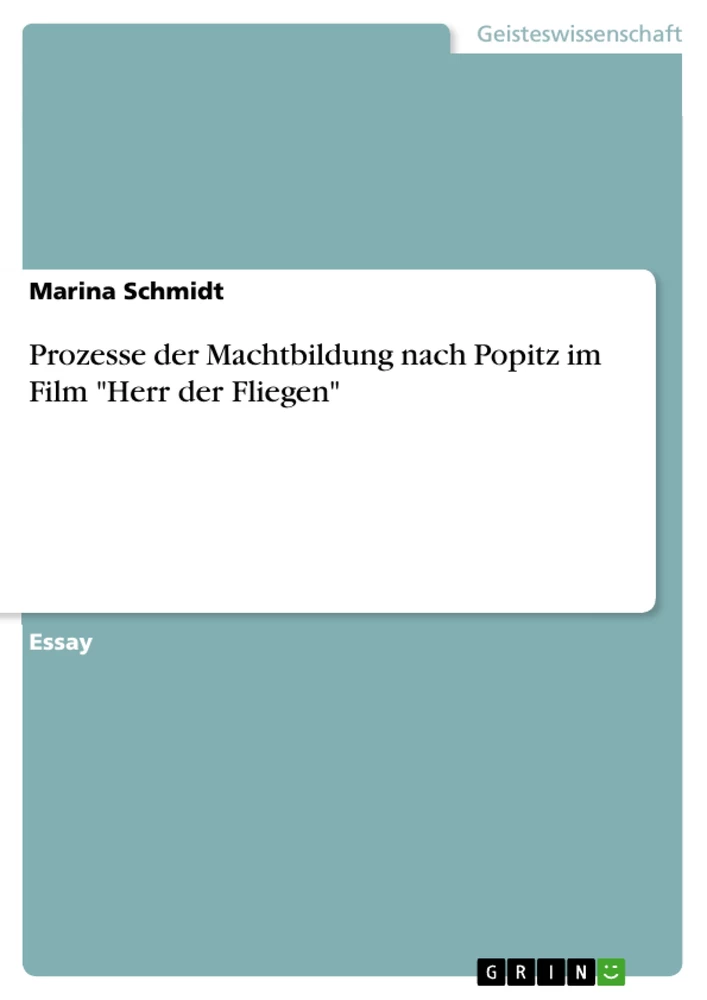
Essay , 2010 , 9 Seiten , Note: 1,3
Autor:in: Marina Schmidt (Autor:in)
Soziologie - Recht und Kriminalität
Leseprobe & Details Blick ins Buch