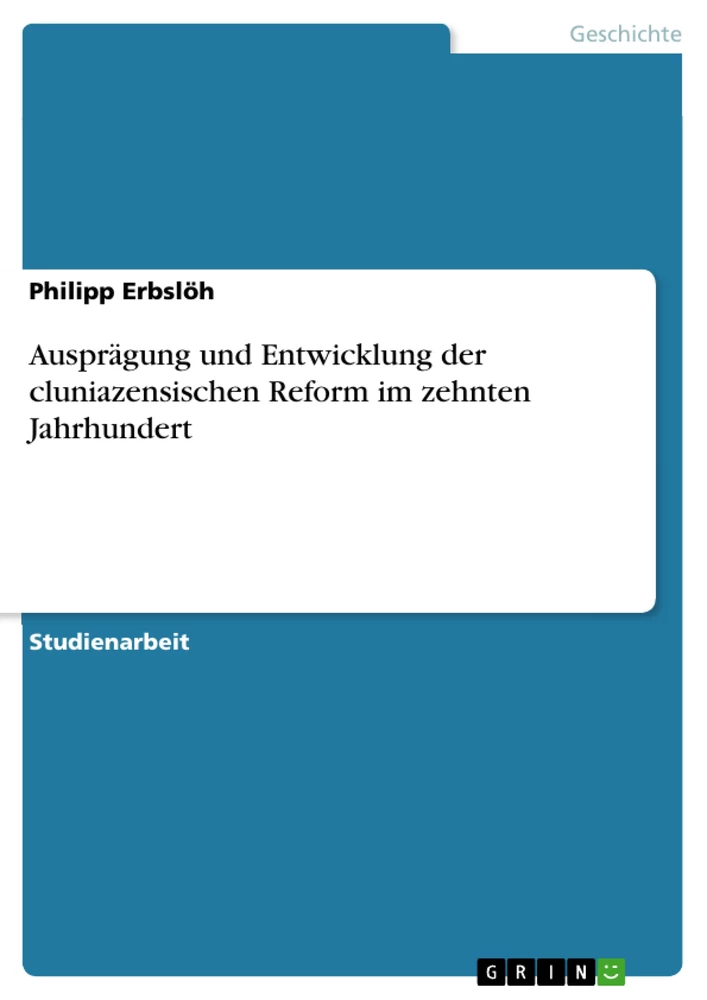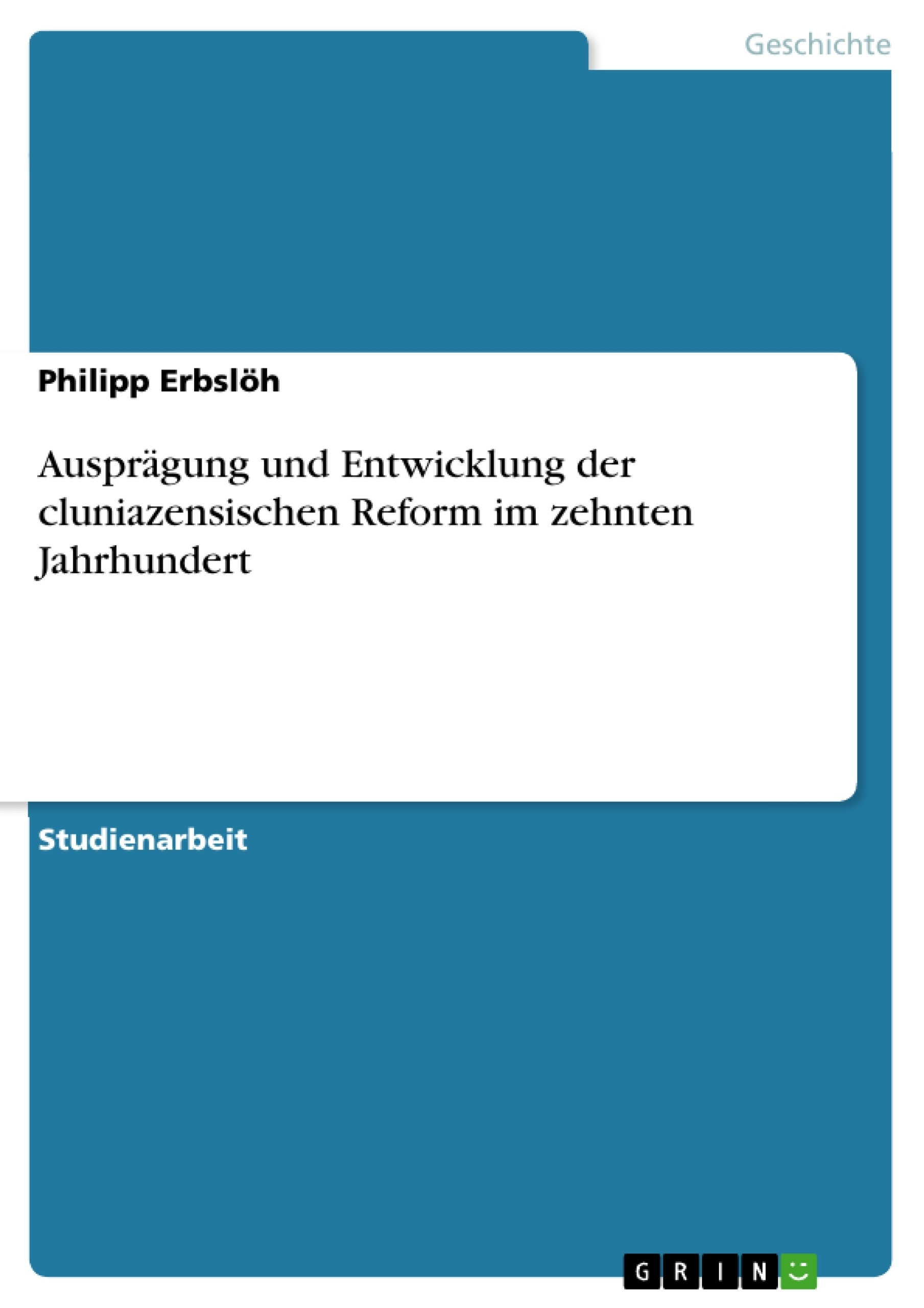Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den historischen Anfängen des Klosters Cluny im burgundischen Frankreich. Der Schwerpunkt der Betrachtung wurde auf die Entwickelung des Klosters im ersten Jahrhunderts seines Bestehens gelegt.
Die Entwickelung wird unter dem Aspekt der cluniazensischen Klosterreform verfolgt werden, und dazu sind in einem ersten einleitenden Schritt die Ausgangsbedingungen der Klostergründung zu untersuchen. Welche Faktoren bedingten, dass Cluny auf eben diese Weise gegründet wurde? Auf den reformerischen Charakter des Klosters und die Orientierung eines monastischen Ideals an der apostolischen Urkirche bezieht sich der zweite Teil der Untersuchung. Abschließend werden die Beziehungen des, qua seiner Gründungsurkunde freien Klosters, zu sowohl den weltlichen als auch den geistlichen Gewalten seiner Zeit herausgestellt. Der letzte Abschnitt gliedert sich jeweils in die Betrachtung des Verhältnisses zu lokalen Mächten und die überregionalen Gewalten auf. Für alle drei Teile der Arbeit war das umfangreiche Werk von Joachim Wollasch hilfreich. An erster Stelle für eine Untersuchung der Cluniacensis Ecclesia sei hier Dietrich W. Poeck genannt. Die Betrachtung des Verhältnisses von Cluny und dem Papsttum stützt sich vornehmlich auf den Aufsatz von Franz Neiske „Das Verhältnis Clunys zum Papsttum“. Dagegen bezieht sich die Darstellung der Beziehungen zum Episkopat vornehmlich auf die Thesen Ulrich Winzers. Johannes Fechters hat das Verhältnis Clunys zu den Ständen beschrieben, in Beziehung gesetzt habe ich seine Untersuchung mit denen von Joachim Wollasch, die auch ergiebig hinsichtlich der Beziehung von Episkopat und Cluny waren. Zur Analyse der Beziehungen Clunys zum französischen Königtum habe ich einen Aufsatz Gert Melvilles herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
I. Ursprung der cluniazensischen Klosterreform
I. 1. Historische Einordnung der Gründung Clunys
I. 2. Besondere Vorzeichen bei der Gründung hinsichtlich der Entwicklung der Reformen
I. 3. Privilegiensicherung und Ausbau
II. Die cluniazensische Klosterreform
II. 1. Cluniazensische Reformansätze
II. 2. Cluniazensische Klosterreform unter spezieller Berücksichtigung des urkirchlichen Ideals
III. Die Beziehungen Clunys zu geistlichen und weltlichen Mächten
III. 1. Die Beziehung Clunys zur geistlichen Macht
III. 1.1. Cluny und der Heilige Stuhl
III. 1. 2. Cluny und das Episkopat
III. 2. Die Beziehungen Clunys zur weltlichen Macht
III. 2. 1. Cluny und der regionale Adel
III. 2. 2. Cluny und das französische Königtum
Schlussteil
IV. Literatur
Quellen:
Literatur