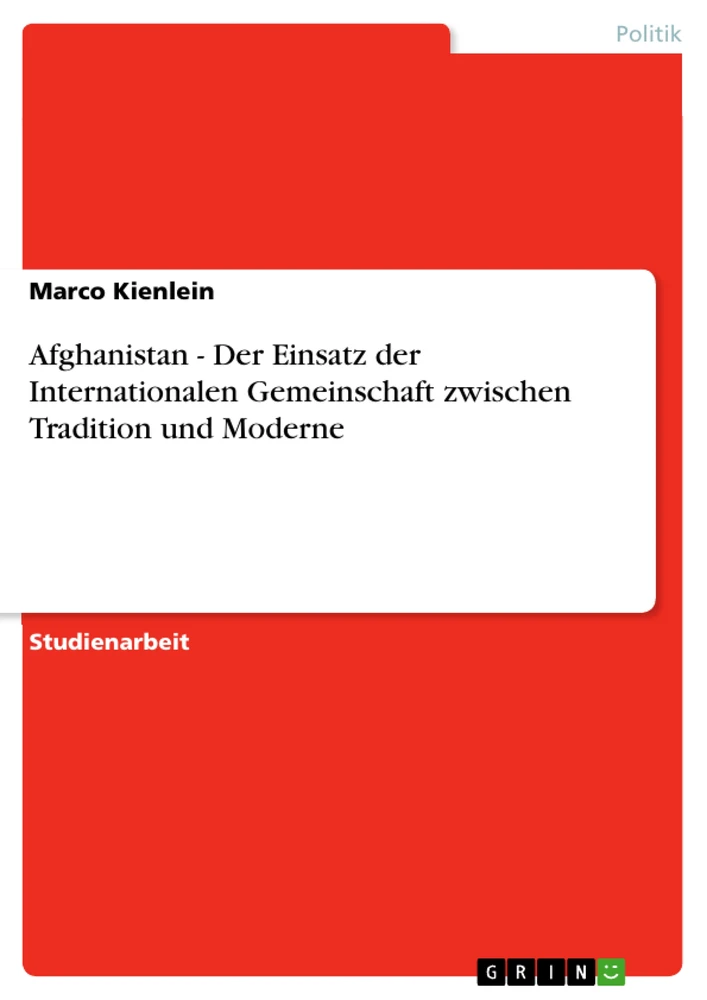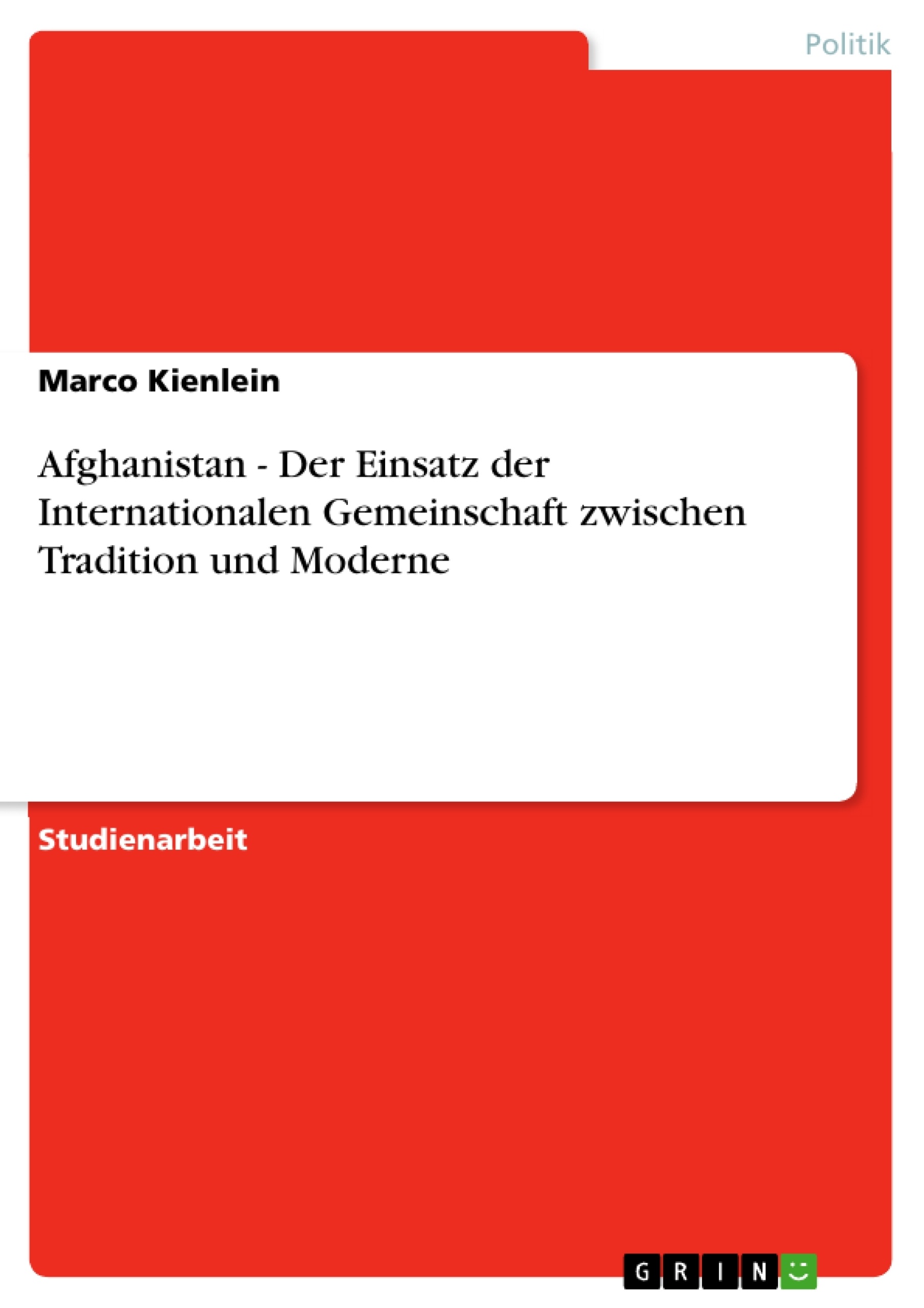Die Arbeit entstand im Rahmen des friedenswissenschaftlichen Weiterbildungsstudiums des Instituts „Frieden und Demokratie“ der Fernuniversität in Hagen und widmet sich der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Afghanistan.
In ihr wird untersucht, welchen Einfluss die traditionellen Strukturen Afghanistans auf die UN-Mission haben und wie wirksam moderne Instrumente der Friedenskonsolidierung sind.
Der erste Abschnitt befasst sich mit der Geschichtschreibung des Landes und geht folgender These nach:
Die Geschichte sowie die Erfahrungen der Ethnien in Afghanistan erschweren den Prozess des Statebuilding.
Dazu wird im Kapitel zwei die Genese des Staates Afghanistan hinsichtlich der Bedeutung der Ethnien sowie ethnischer Konflikte untersucht. Die betrachteten Zeiträume reichen von den Anfängen Afghanistans bis zum Bürgerkrieg der Mudschaheddin. Der, in Vergangenheit und Gegenwart, besonderen Rolle der Taliban wird im Abschnitt 2.2 Rechnung getragen, bevor eine für Afghanistan typische soziale Ordnung - der Stamm - skizziert wird. Im Anschluß werden die Ergebnisse des zweiten Kapitels zusammengefasst und abschließend Möglichkeiten aufgezeigt, welche den Staatsbildungsprozess optimieren könnten.
Der dritte Abschnitt dient der Darstellung und Bewertung eines Praxisbeispiels. Aus den friedenskonsolidierenden Instrumenten der internationalen Gemeinschaft wird das deutsche Konzept der Provincial Reconstruction Teams (PRT) herausgenommen. Diese zivil-militärischen Teams sollen an politisch und strategisch wichtigen Knotenpunkten des Landes stationiert werden und diese zu Stabilitätsinseln formen. Dadurch sollen Wiederaufbau-, Entwicklungs- und Friedensprozesse in die Weite Afghanistans getragen werden. Nach der Modellerläuterung wird der These nachgegangen, dass die PRTs einen wesentlichen Beitrag für die Sicherheit sowie den Wiederaufbau in Afghanistan erbringen.
Inhalt
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung und Fragestellung
2. Religion, Ethnizität und Stammeskultur als Herausforderung
2.1 Die Geschichte Afghanistans im Spiegel der Ethnien
2.2 Die Taliban
2.3 Die Stammesgesellschaft der Paschtunen
2.4 Statebuilding in Afghanistan - aber wie?
3. Die deutschen Provincial-Reconstruction-Teams in Afghanistan
3.1 Geschichte der PRTs in Afghanistan
3.2 Konzept und Aufgaben der deutschen PRTs
3.3 Der Beitrag der PRTs zur Sicherheit
3.4 Der Beitrag der PRTs zum Wiederaufbau
3.5 Fazit und Empfehlungen
4. Schlussbetrachtung und persönliches Resümee
5. Literatur:
5.1 Primärquellen:
5.2 Referenzen aus persönlichen Gesprächen
5.3 Sekundärquellen:
6. Anhang
6.1 Protokoll des Telefoninterviews mit Vertreter des BMZ
6.2 Protokoll des Telefoninterviews mit einem Vertreter des BMI
6.3 Protokoll des Interviews mit einem Vertreter des AA
6.4 Schriftlich beantwortete Fragen des Vertreters des BMVg