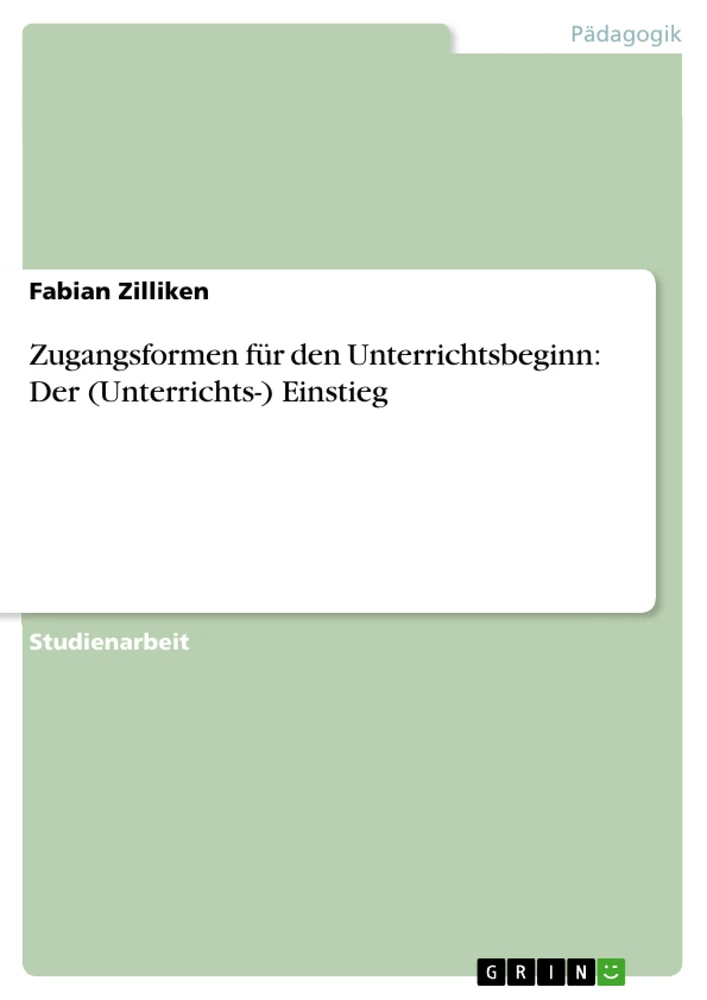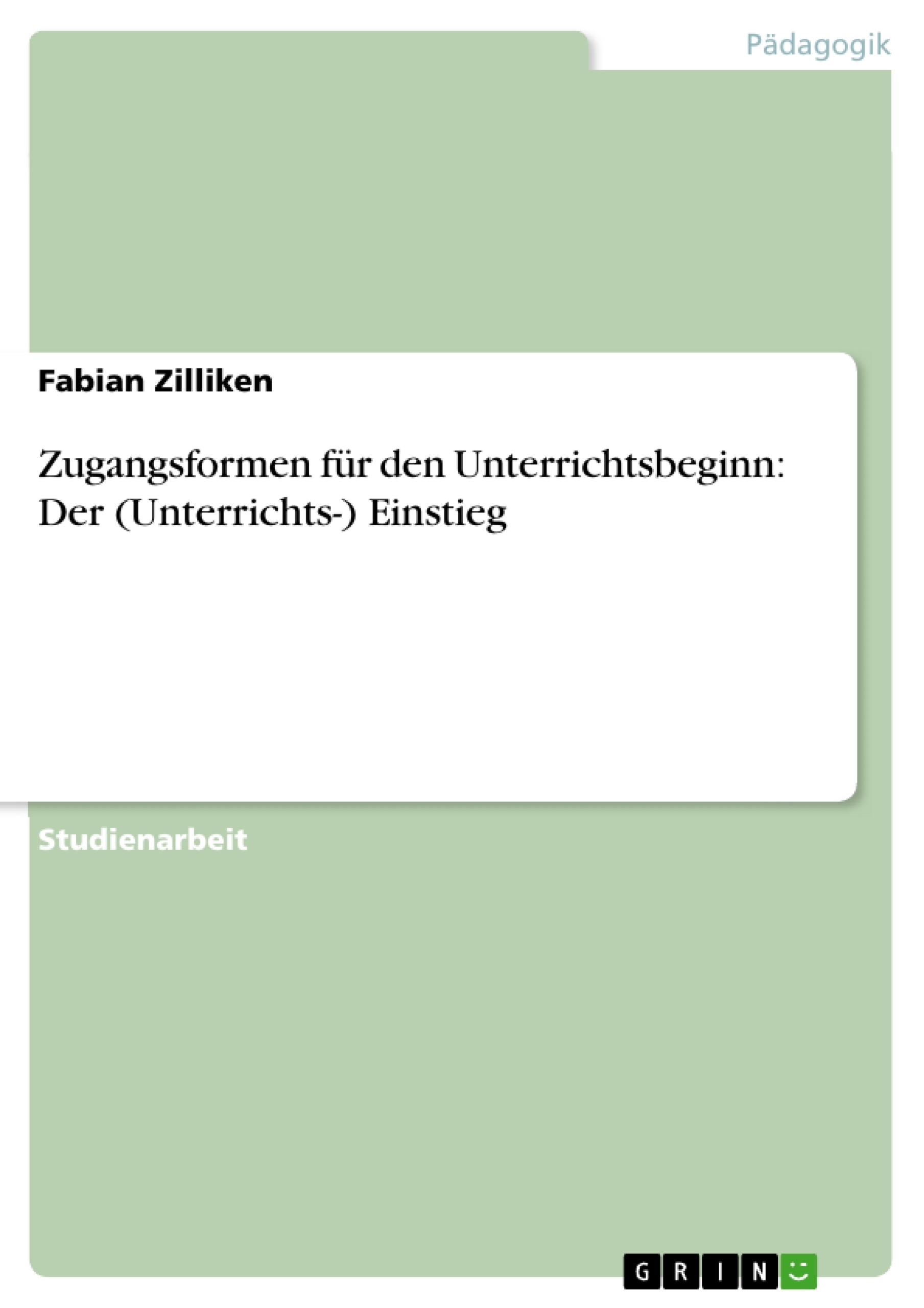Diese Seminararbeit wurde zu einer fachdidaktischen Veranstaltung des Fachs Mathematik ausgearbeitet. Sie befasst sich aber nicht explizit mit dem Fach Mathematik selbst. Ihren großen Schwerpunkt setzt sie in der Schulpädagogik und der allgemeinen sowie praxisnahen Umsetzung der Theorie in die Praxis.
„In dieser Seminararbeit befasse ich mich ausschließlich mit den Zugangsformen für einen Unterrichtsbeginn, - den (Unterrichts-) Einstieg. Nahe und eng verwandte Termini, die sich unter anderem mit den sog. „Stundeneröffnungsritualen“ auseinandersetzen, waren und sind nachwievor nicht Gegenstand dieser Ausarbeitung, da sie - auch wenn sie an die Thematik angrenzen und teilweise punktuell in sie überführen - einen anderen unterrichtlichen Rahmen abdecken, den es in einer separaten Auseinandersetzung abzuhandeln gilt.“
Im Verlauf der Ausarbeitung gehe ich auf die allgemeinen Merkmale, Aufgaben und Funktionen des (Unterricht-) Einstiegs ein - einerseits wie sie in der Theorie gedacht und andererseits in der Praxis umgesetzt werden können (und sollten).
Hochinteressant und für jegliche Prüfungslehrprobe äußerst hilfreich, sind die zahlreichen Beispiele und Methoden für (Unterrichts-) Einstiege, die in 5 Kategorien und insgesamt 23 Einzelfallbeispiele bzw. (Unterricht-) Einstiegs-Methoden gegliedert sind. Sie lassen sich auf alle Schulfächer der Sekundarstufe 1 & 2 übertragen und finden somit überall ihre Anwendung. Zudem bilden sie für jede Lehrerin und jeden Lehrer ein perfektes Repertoire an unterrichtlichen Einstiegsmöglichkeiten, um in eine erfolgreiche Unterrichtsstunde einzutauchen...
Inhaltsverzeichnis
1. Der (Unterrichts-) Einstieg - ein allgemeiner Überblick
1.1 Ein Hinweis vorweg
1.2 Begriffsaggregation zum (Unterrichts-) Einstieg
1.3 Allgemeine Beispiele für (Unterrichts-) Einstiege aus dem schulischen Alltag
1.4 Der (Unterrichts-) Einstieg und dessen Bedeutung für den Unterricht
1.5 Der schulgeschichtliche Ursprung des (Unterricht-) Einstiegs
2. Die Aufgaben und Funktionen des (Unterricht-) Einstiegs
2.1 Die Aufgabe und Funktion des (Unterricht-) Einstiegs in der Theorie
2.2 Die Aufgabe und Funktion des (Unterricht-) Einstiegs in der Praxis
3. Didaktische Merkmale von (Unterrichts-) Einstiegen
3.1 Didaktische Merkmale guter (Unterrichts-) Einstiege
4. Beispiele für (Unterrichts-) Einstiege
4.1 Die fünf Kategorien
5. Schlusswort
Quellen
6. Literaturverzeichnis
6.1 Genutzte Literatur
6.2 Weiterführende Literatur