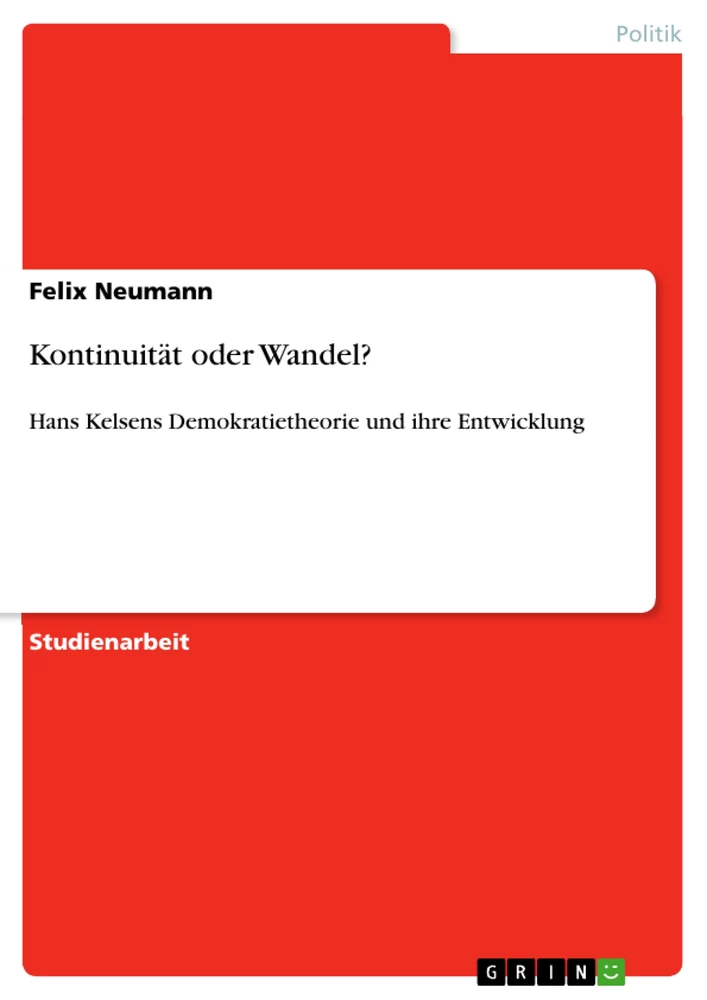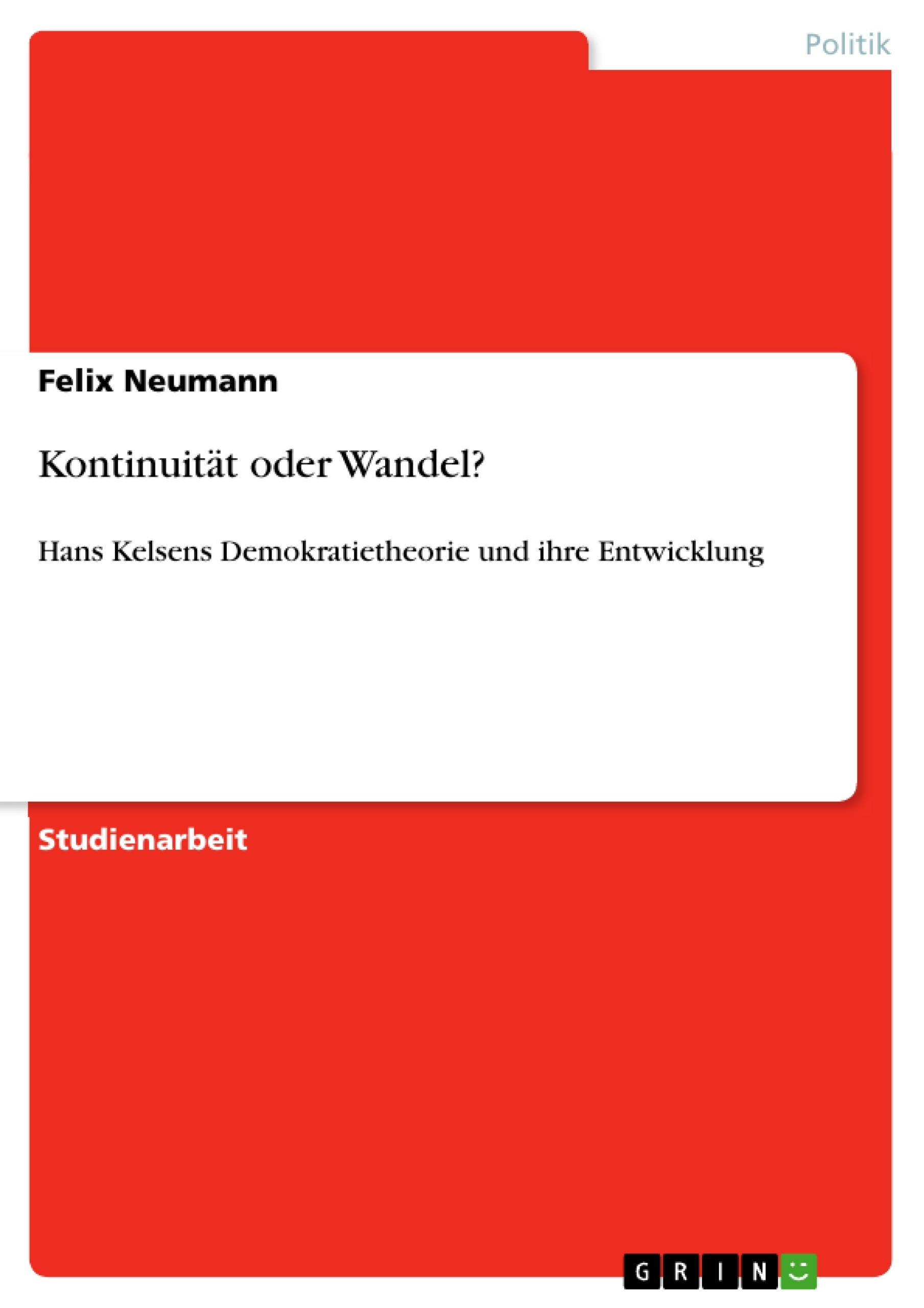Als am Abend des 30. Januar 1933 SA-Verbände durch das Brandenburger Tor zogen und ihren Sieg über die von ihnen gehasste Weimarer Demokratie feierten, wurde allen im Deutschen Reich lebenden Menschen klar, die nicht in die Kategorien der Nationalsozialisten passten, dass für sie nun gefährliche Zeiten angebrochen waren. Die Nationalsozialisten zögerten nicht lange und begannen sofort mit dem Kampf gegen alle ihre Feinde. Gerade Wissenschaftler, die jüdischer Herkunft waren oder demokratischen Parteien nahe standen, wurden schon am 7. April 1933 durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus der Hochschullandschaft entfernt. Der zunehmenden Perspektivlosigkeit und Verfolgung ausgesetzt, zogen diese Wissenschaftler in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in das benachbarte europäische Ausland. Jedoch mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 und der Ausdehnung des Machtbereiches Hitlers, sahen sich die meisten der Emigranten nun gezwungen, in die weiterentfernten Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Mit ihrer Emigration ließen die Auswanderer Deutschland keineswegs hinter sich, sondern beschäftigten sich in den ,,Deutschlandanalysen“, wie die Untersuchungen der Geflüchteten bezeichnet werden, weiter mit ihrer Heimat. Die Vorstellungen der Emigranten blieben jedoch im Exil nicht die gleichen, sondern wurden durch neue Ansichten von Kultur, Nation, Staat und Herrschaft ergänzt, die dann auch Einfluss in ihre Arbeiten fanden.
Einer dieser Emigranten war der österreichische Jurist Hans Kelsen. Auch Kelsen flüchtete im Frühjahr 1933 vor den Nationalsozialisten in die Schweiz, da man ihm aufgrund seiner sozialdemokratischen Gesinnung seine Professur in Köln entzogen hatte. Infolge des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges emigrierte er dann 1939 in die USA. Dort verfasste er, wie auch schon vor seiner Emigration, verschiedene Werke über Herrschaft, Demokratie, Staat und Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Thematische Einführung
1.2 Zum Stand der Forschung und dem Forschungsbeitrag der Arbeit
1.3 Forschungsfrage, methodisches Vorgehen und Aufbau der Arbeit
2 Darstellung der Demokratietheorie Hans Kelsens
2.1 ,,Vom Wesen und Wert der Demokratie“ (1920)
2.1.1 Persönlicher und historischer Kontext
2.1.2 Strukturmerkmale des Werkes
2.2 „Vom Wesen und Wert der Demokratie“ (1929)
2.2.1 Persönlicher und historischer Kontext
2.2.2 Strukturmerkmale des Werkes
2.3 „Verteidigung der Demokratie“ (1932)
2.3.1 Persönlicher und historischer Kontext
2.3.2 Strukturmerkmale des Werkes
2.4 „Was ist Gerechtigkeit?“ (1953)
2.4.1 Persönlicher und historischer Kontext
2.4.2 Strukturmerkmale des Werkes
3 Beispiele für Kontinuität und Wandel in Kelsens Demokratietheorie
3.1 Merkmale für Kontinuität
3.2 Merkmale für Wandel
4 Fazit
5 Literaturverzeichnis
5.1 Primärliteratur:
5.2 Sekundärliteratur: