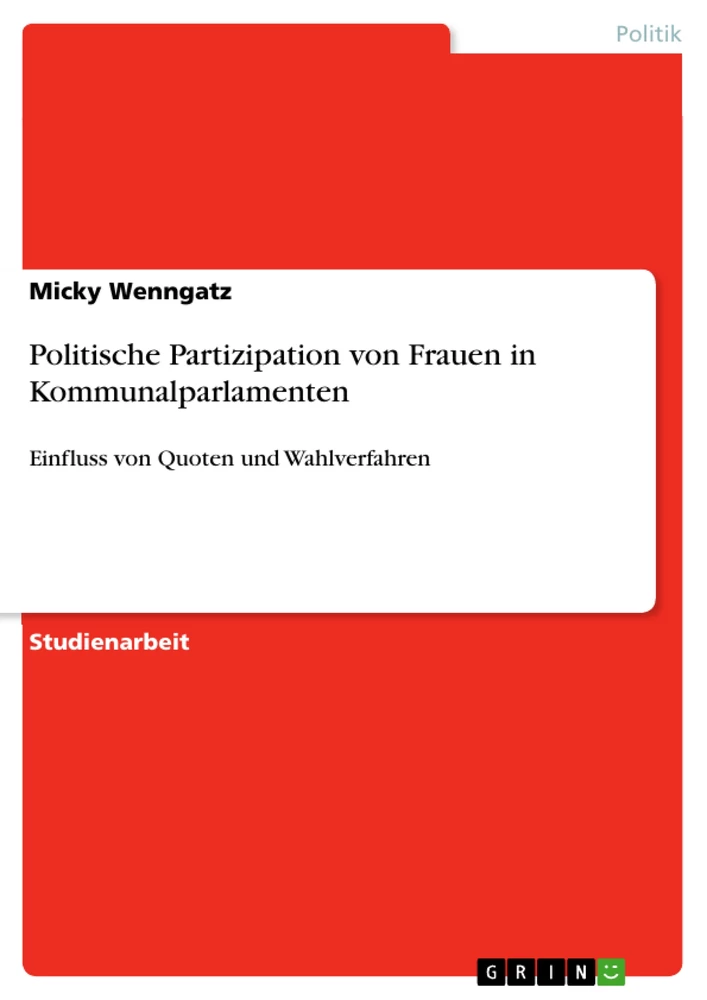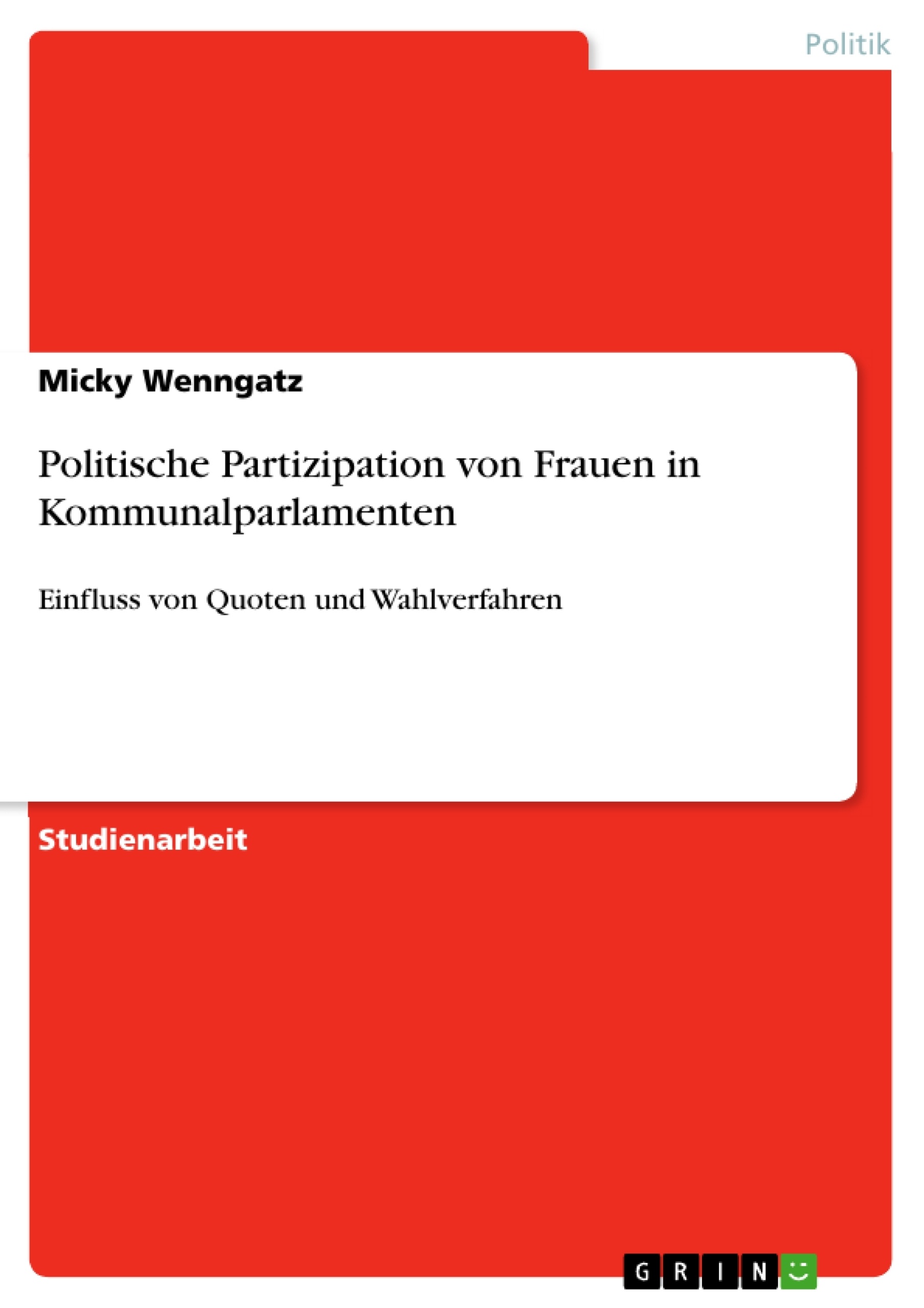Am 19. Januar 1919 durften Frauen in Deutschland zum ersten mal an Wahlen teilnehmen. Damit ist das aktive wie das passive Frauenwahlrecht in Deutschland stolze 90 Jahre alt. Doch der Weg von der formalen Gleichberechtigung von Frauen im Wahlrecht zur tatsächlichen Gleichstellung von Frauen auf der politischen Bühne ist noch lange nicht zu Ende gegangen.
Zwar ist der Anteil der Frauen im Bundestag mit im Jahr 2002 32,2 Prozent (BMFSFJ, 2008) deutlich höher als derjenige im ersten Reichstag 1920 mit 8 Prozent (Paulus, 2007), von einer paritätischen Besetzung des Gremiums kann allerdings auch heute noch nicht die Rede sein.
Ähnlich sieht es noch immer in den Kommunalparlamenten aus. Obwohl in
Artikel 3 GG, Satz 2 folgendes deutlich gemacht wird, „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ wird die Unterrepräsentanz von Frauen in kommunalen Gremien schon bei
einem Vergleich der deutschen Großstädte deutlich (vgl. Holtkamp, 2009).
Berücksichtigt man dann noch die Tatsache, dass Benachteiligung von Frauen sich auf dem Land häufig stärker auswirkt als in der Stadt (vgl. Heepe, 1989), zeichnet sich deutlich ab, dass die oben zitierte Verfassungsnorm mit der für Frauen erlebbaren Verfassungswirklichkeit in der Bundesrepublik noch wenig gemein hat.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Allgemeines
Erklarungsmodelle fur Unterreprasentanz von Frauen
Partizipation
Quote
Mandatsrelevanz
Normative Rahmenbedingungen
Bayerisches Kommunalwahlrecht
Nominierungsverfahren
Quantitative Untersuchung im Vergleich Munchen - Bad Tolz
Fragestellung und Hypothesen
Ergebnisse der Stadtratswahlen in Bad Tolz und in Munchen
Berucksichtigung der Quote
Der Einfluss des Wahlverfahrens
Fazit
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis