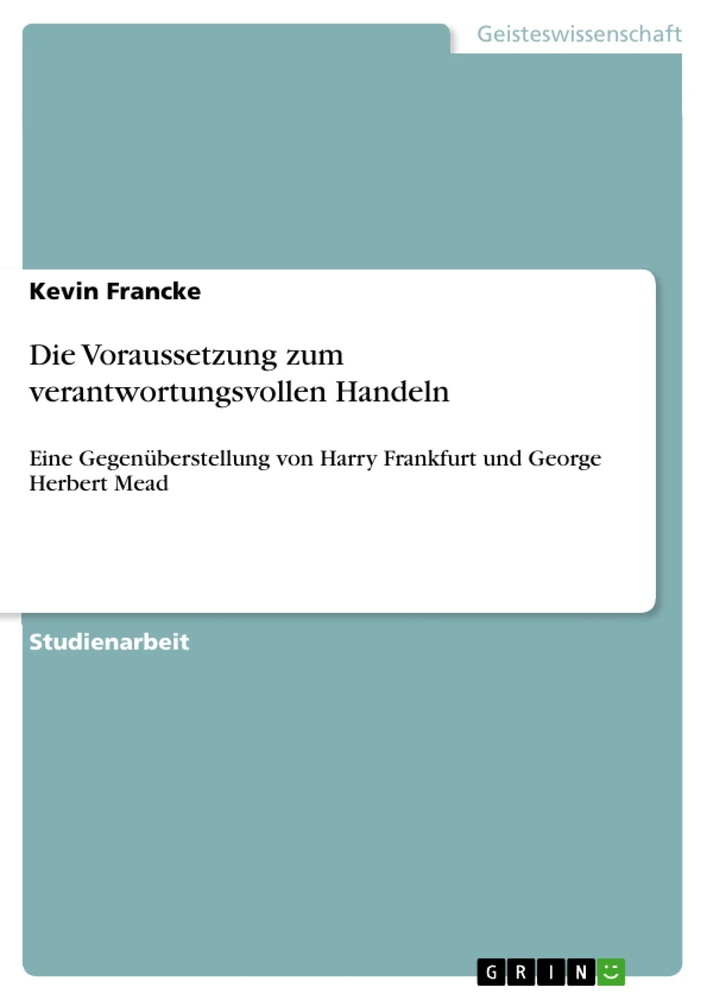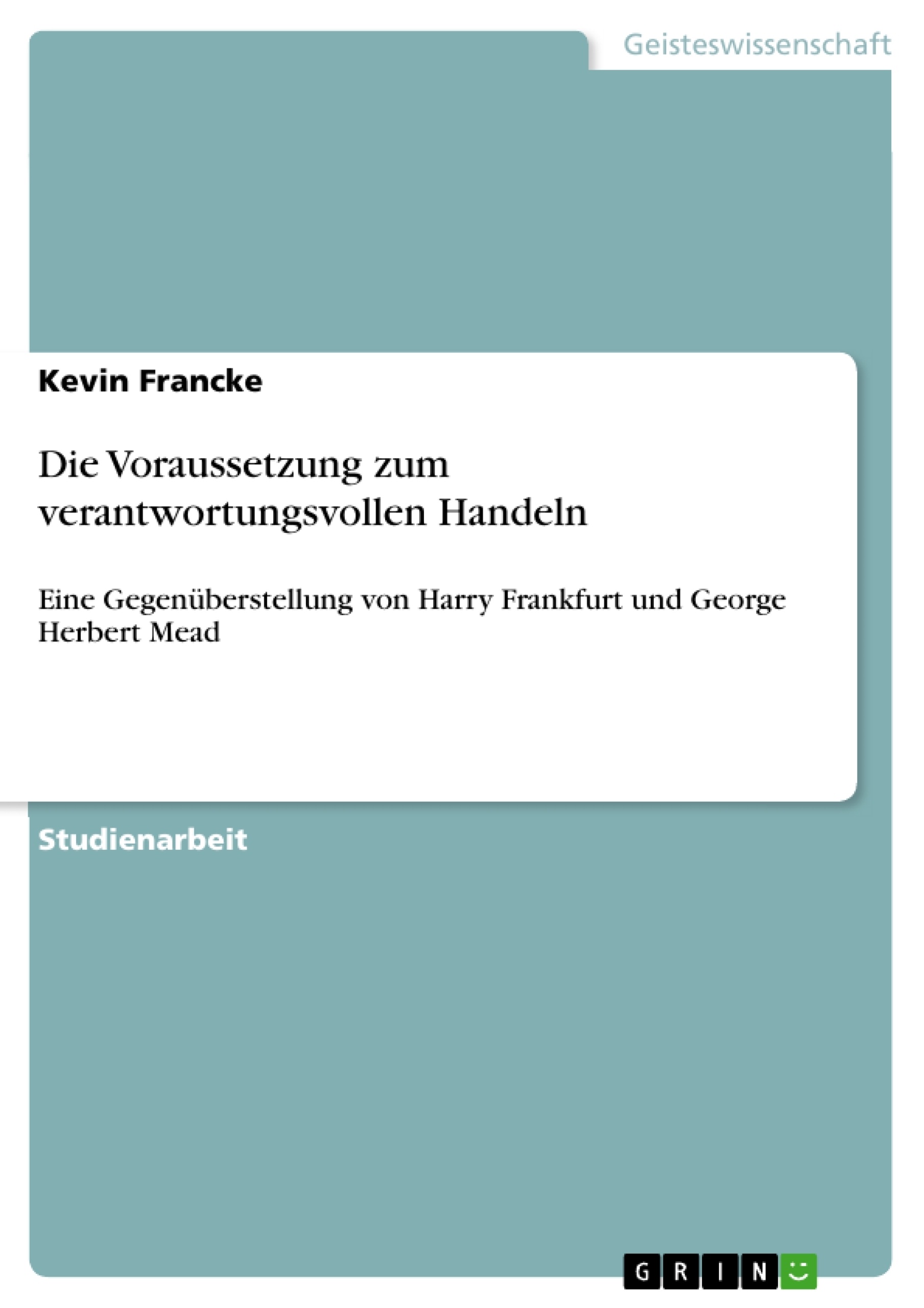Die Frage nach dem Wesen des Menschen scheint fast von selbst die Frage nach dem handelnden Menschen oder sogar nach dem frei und verantwortungsvoll oder aus Gründen handelnden Menschen einzuschließen. Wer oder was der Mensch ist soll sich demnach erschließen, wenn die Frage nach der Entstehung der Handlung oder der Handlungsabsicht geklärt ist, welche originäres Merkmal des Menschen im Gegensatz zum Tier ist.
Im letzten Jahrhundert haben sich neben vielen anderen Gelehrten und Wissenschaftlern der Sozialphilosoph George Herbert Mead und der Philosoph Harry Frankfurt mit der Frage nach dem Wesen des Menschen beschäftigt, wenn auch mit unterschiedlichem Akzent. Mead geht von der Entwicklung einer individuellen Identität – ähnlich wie Taylor verwendet Mead im englischen Original den Begriff des „self“, aber mit differenter Implikation – in der Gesellschaft aus. Ohne den „verallgemeinerten Anderen“ , welcher den gesammelten moralischen Haltungen der anderen Gesellschaftsmitglieder entspricht, ist es dem Einzelnen nicht möglich, eine Identität, ein „self“ zu entwickeln. Essentiell für das „self“ ist das »ICH« – im englischen „Me“ –, welches durch die verinnerlichten Haltungen der anderen gebildet wird und mitbestimmend auf die individuellen Handlungen einwirkt. Diese drücken sich spontan im »Ich« – im englischsprachigen Original „I“ – als Reaktion des Individuums auf die Haltungen anderer aus; bis zum konkreten Eintreten ist die individuelle Handlung im möglichen Ablauf offen.
Im Unterschied zu Mead entstehen nach Harry Frankfurt Handlungsabsichten in Form von Wünschen in Abhängigkeit von individuellen Bedürfnissen. In so genannten Wünschen zweiter Stufe zeigt sich das reflektierende Individuum, wenn es wünscht, bestimmte Wünsche erster Stufe haben zu wollen. Das Moment der Verantwortung wird sichtbar, wenn die Volitionen zweiter Stufe – gemeint sind Wünsche zweiter Stufe, welche an sich den Wunsch beinhalten, bestimmte Wünsche zu haben, die handlungswirksam werden sollen – zur Umsetzung gelangen, die Handlungen des Individuums in Einklang mit seinen Volitionen zweiter Stufe erfolgen.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
2. FRANKFURT UND MEAD- EINE GEGENUBERSTELLUNG
2.1. Frankfurts Konzept von PersonalitAt
2.2. Meads Theorie der IdentitAt
2.2.1. Gesellschaft
2.2.2. Gesten
2.2.3. Identitat
2.2.4. »Ich« und »ICH«
2.2.5. Moralische Verantwortung bei Mead
2.2.6. Handlungs- und Willensfreiheit bei Mead
2.3. Moralische Verantwortung bei Frankfurt
3. VERGLEICH VON FRANKFURT UND MEAD
3.1. WUNSCHE UND VERNUNFT
3.2. Identitat und Personlichkeit
3.3. Prufung am Beispiel der Suchtigen
4. DER MENSCH ALS NOTWENDIG VERANTWORTLICHEM
GESELLSCHAFTSWESEN
LITERATURNACHWEIS