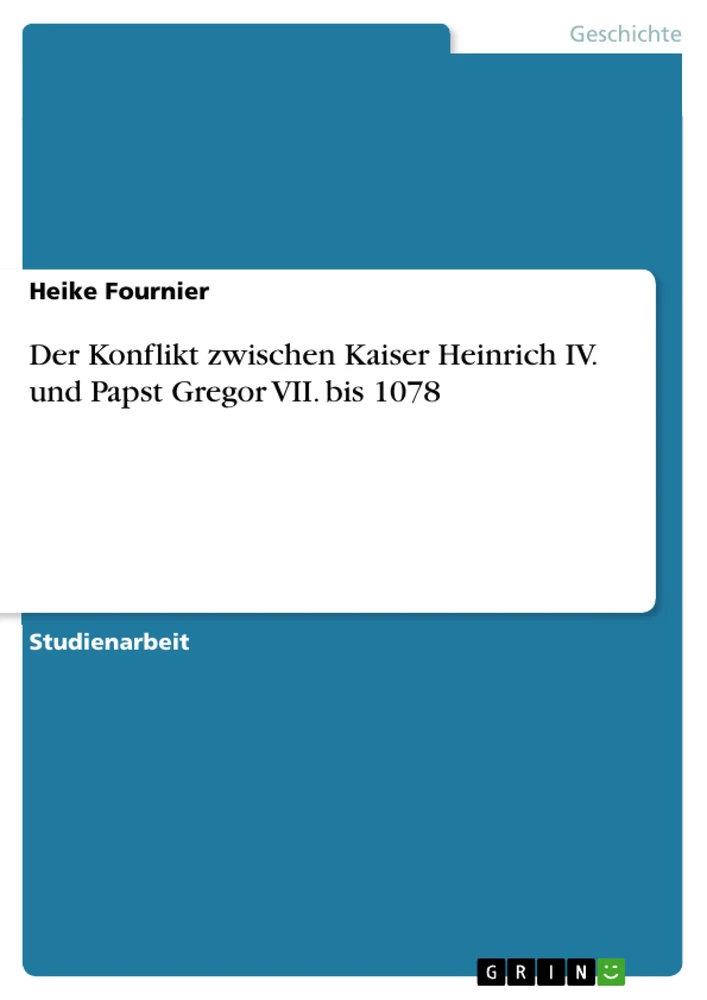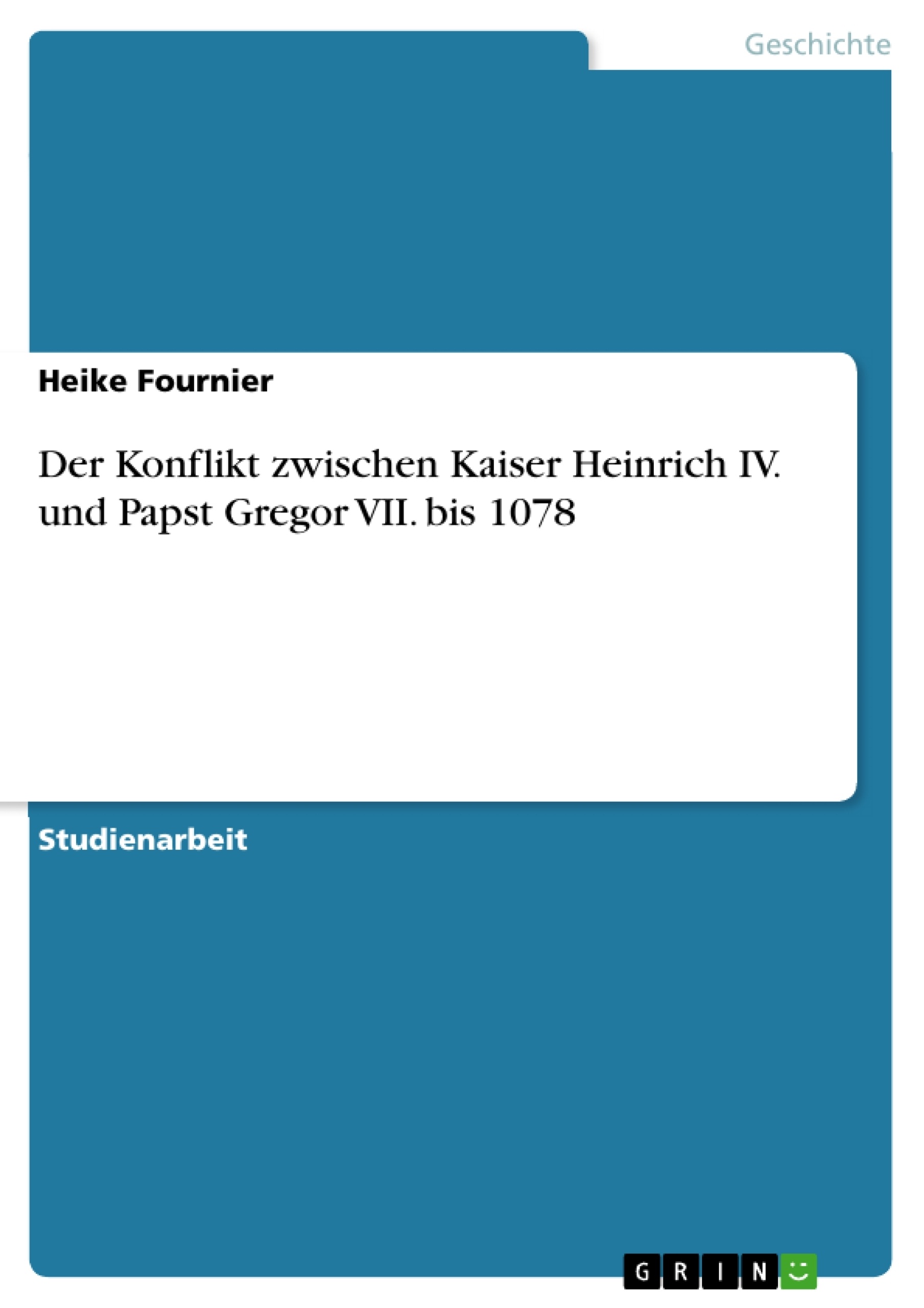Zwei große und für die Geschichtsschreibung wichtige Persönlichkeiten bestimmten den Höhepunkt des Investiturstreites. Auf der Seite der weltlichen Herrschaft stand Heinrich IV. und auf der Seite der geistlichen Herrschaft Papst Gregor VII.
Auch wenn es zu Beginn des Pontifikates Gregors VII. noch nicht nach einem offenen Konflikt zwischen regnum und sacerdotium aussah, wandelte sich dies im Laufe der Zeit.
Zwei machtbewusste und sehr zielorientierte Persönlichkeiten trafen aufeinander und es entwickelte sich ein Konflikt besonderen Ausmaßes. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein König durch einen Papst gebannt. Bonizo von Sutri beschrieb diesen Moment 1076 wie folgt: „Als die Kunde von der Bannung des Königs an die Ohren des Volkes drang, erzitterte unser ganzer römischer Erdkreis.“
In meiner Arbeit möchte ich die beiden Personen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. zuerst genauer betrachten und ihre persönlichen Hintergründe beleuchten. Über Kaiser Heinrich IV. existieren bereits über seine Kindheit- und Jugendjahre diverse Quellen, in denen seine Erziehung und wichtige Stationen seines Lebens erwähnt werden. Die Quellen über die Kindheit- bzw. Jugendjahre Gregors VII. bis hin zu seinem Pontifikat sind eher als spärlich zu bezeichnen. Gregor VII. hat selbst in dem von ihm verfassten Register nur wenig über seine Herkunft hinterlassen. Trotz der teilweise schlechten Quellenlage lohnt es sich, sich mit den frühen Jahren der beiden auseinander zu setzen, da diese prägend für ihren Charakter und den späteren Führungsstil gewesen sind und vielleicht einige Rückschlüsse auf ihr späteres Verhalten und politisches Vorgehen erlauben.
Des Weiteren werde ich im Laufe meiner Arbeit näher auf den großen Konflikt zwischen Heinrich IV. und Gregor VII. eingehen. Ich werde versuchen die Hintergründe und letztendlichen Auslöser des Konfliktes näher zu betrachten und zu erörtern.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1. Die Person Heinrich IV.
2.1.1 Von der Geburt bis zur Regentschaft
2.1.2 Eigenständige Herrschaft
2.2. Die Person Gregor VII.
2.2.1 Geburtsort
2.2.2 Familie
2.2.3 Kindheit und Jugend
2.2.3.1 Der Lateran
2.2.3.2 Die Erziehung
2.3. Kirchlicher Werdegang bis zur Papstwahl
2.3.1 Subdiakon
2.3.2 Legatentätigkeit in Frankreich und Deutschland
2.3.3 Archidiakon
2.3.4 Das Laterankonzil 1059
2.3.5 Die milites Christi
2.3.6 Die Papstwahl am 22.04.1073
2.3.7 Das Pontifikat
2.4. Der Konflikt
2.4.1. Anbahnung des Konfliktes
2.4.2. Der offene Kampf
3. Schluss
3.1. Zusammenfassung
3.2. Beurteilung
4. Literaturverzeichnis