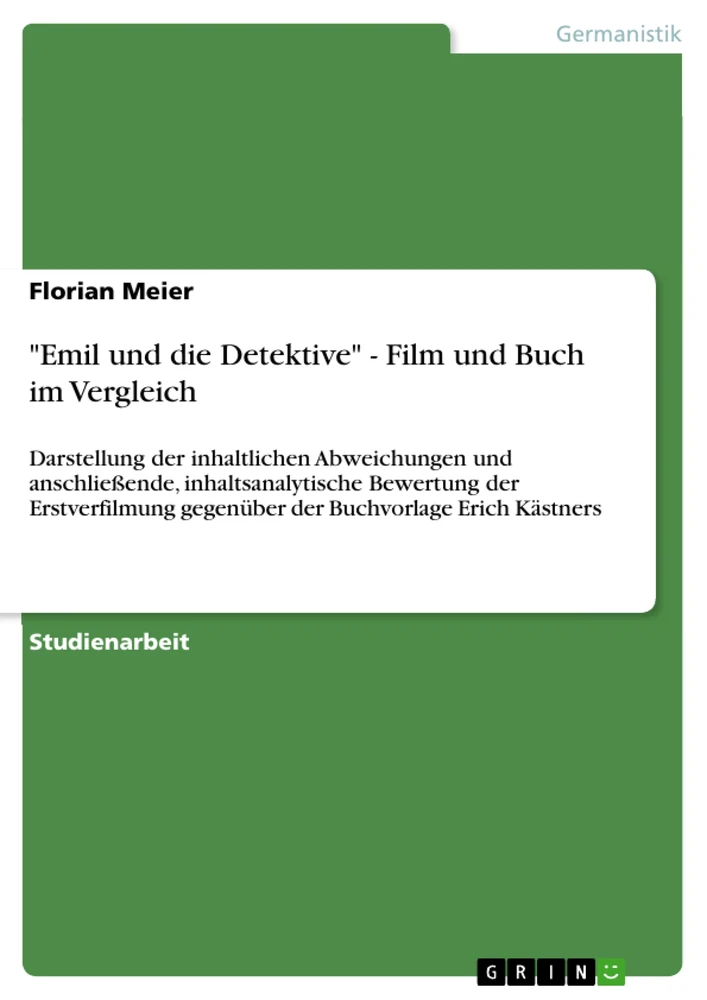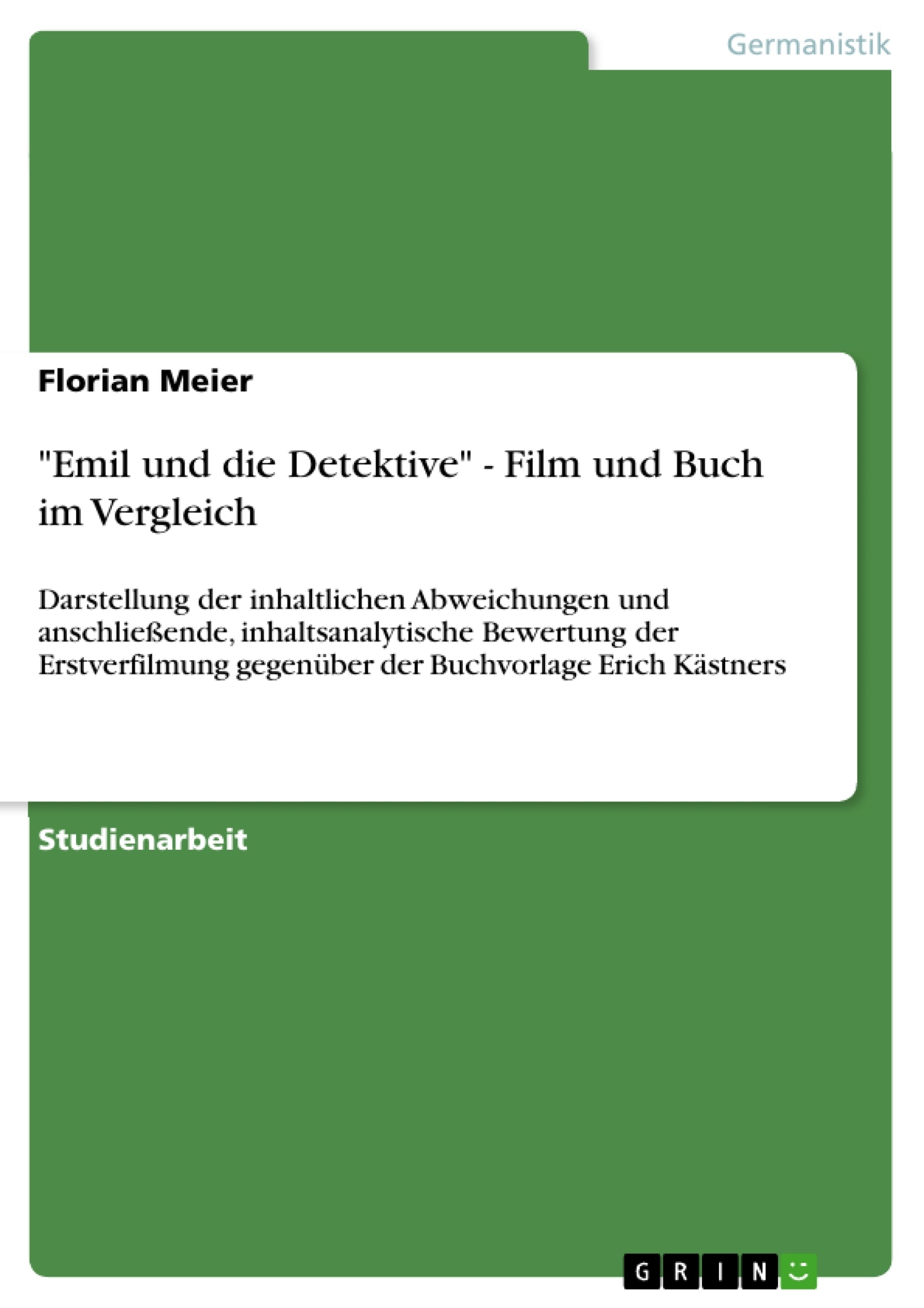„Euch kann ich’s ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber unerwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen.“
Mit diesen zwei Sätzen beginnt eines der erfolgreichsten Kinder- und Jugendbücher, das jemals veröffentlicht wurde. Es handelt sich dabei um das Werk „Emil und die Detektive“ von Erich Kästner. Er veröffentlichte es 1929 und erlangte damit innerhalb kürzester Zeit einen Bekanntheitsgrad, der bis heute bei Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen beachtlich geblieben ist. Die Geschichte des kleinen Emil in der Großstadt Berlin erfreut sich ungebrochener Beliebtheit und ist Grundlage vieler seitdem veröffentlichter Kinder-Detektivgeschichten. Dabei muss man beachten, dass Kästner mit diesem Werk nicht nur einen sehr bedeutenden Teil zur Kinder- und Jugendliteratur beigetragen hat, sondern genauso auch eine große Rolle in der deutschen Filmgeschichte gespielt hat . Bereits 1931 verfilmte Gerhard Lamprecht „Emil und die Detektive“ nach dem Drehbuch von Billy Wilder und es wurde ein voller Erfolg auf der Leinwand . Der Film gilt als einer „der bedeutendsten Filme der frühen Tonfilmzeit“ und wird heute auch als erster Klassiker der deutschen Kinderfilmproduktion bezeichnet .
Bei der Betrachtung vom Buch und der Erstverfilmung fällt aber auf, dass es einige inhaltliche Differenzen gibt. Schon direkt am Anfang merkt der Rezipient, dass der Film in der Handlung anders beginnt, wie das Buch. Genau diese Differenzen sind der Untersuchungsgegenstand dieser Ausarbeitung.
Um jedoch diese Unterschiede verständlich darlegen zu können, werden zunächst einige Grundbegriffe und Elemente der systematischen Filmanalyse vorgestellt. Unterschiede in den Einstellungsgrößen, verschiedene Kamerabewegungen, Einstellungsverbindungen und Blickperspektiven werden kurz dargelegt und erleichtern das Verständnis der nächsten Abschnitte dieser Arbeit.
Darauffolgend werden dann die Filmabschnitte vorgestellt, die inhaltlich vom Buch abweichen. Es wird jeweils zuerst beschrieben, wie Szenen im Film dargestellt werden und in welcher Form sie eine Abweichung zur Buchvorlage aufweisen.
Anschließend wird im nächsten Gliederungsabschnitt eine inhaltsanalytische Beurteilung der Differenzen vorgenommen, welche schließlich die Grundlage einer fundierten Kritik bildet, die den gesamten Film im letzten Gliederungspunkt bewertet.
Inhaltsverzeichnis
1. „Emil und die Detektive“ – Ein Roman und seine Verfilmung
2. Grundbegriffe und Elemente der systematischen Filmanalyse
2.1 Die Einstellungsgrößen
2.3 Die Einstellungsverbindungen
2.4 Die Kamera- und Blickperspektiven
3. „Emil und die Detektive“ – Inhaltliche Abweichungen der Erstverfilmung von der Buchvorlage
3.1 Der Denkmal – Streich
3.2 Das mit Schlafmittel versetzte Bonbon
3.3 Die Verfolgung mit der Straßenbahn
3.4 Überbringung der Nachricht an Emils Großmutter
3.5 Der versuchte Rück – Diebstahl
3.6 Die Jagd auf Grundeis
3.7 Ankunft in Neustadt
3.8 Filmbegleitende, inhaltliche Differenzen zur Buchvorlage
4. Inhaltsanalytische Beurteilung der Abweichungen im Film
5. Die Erstverfilmung von „Emil und die Detektive“ – Inhaltlich teilweise anders akzentuiert, aber formal dennoch geglückt?
Literatur- und Quellenverzeichnis