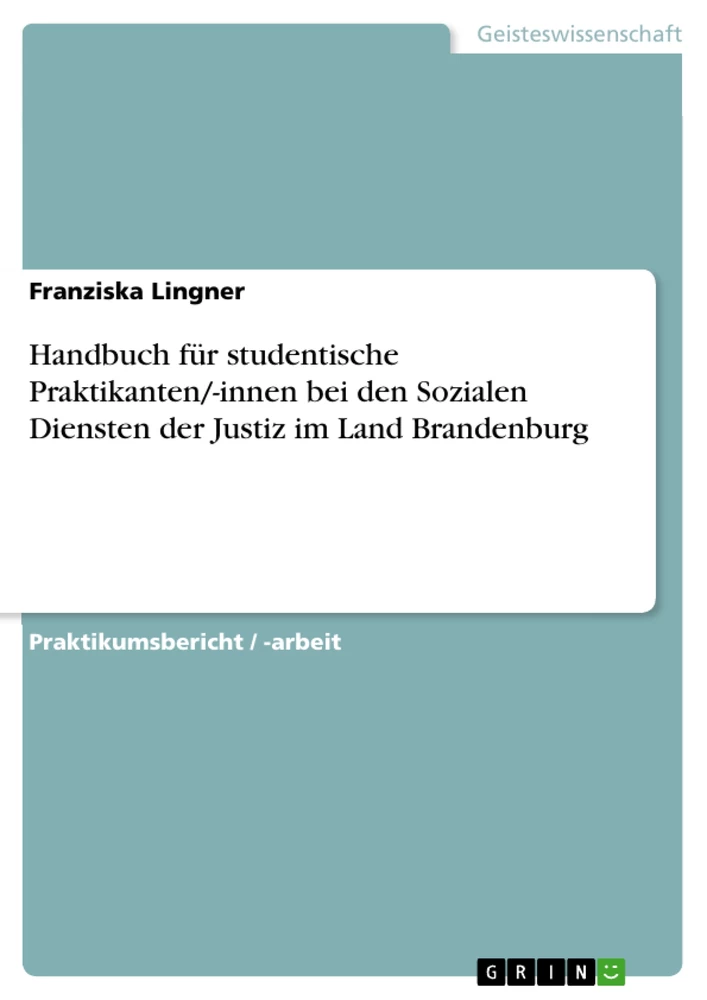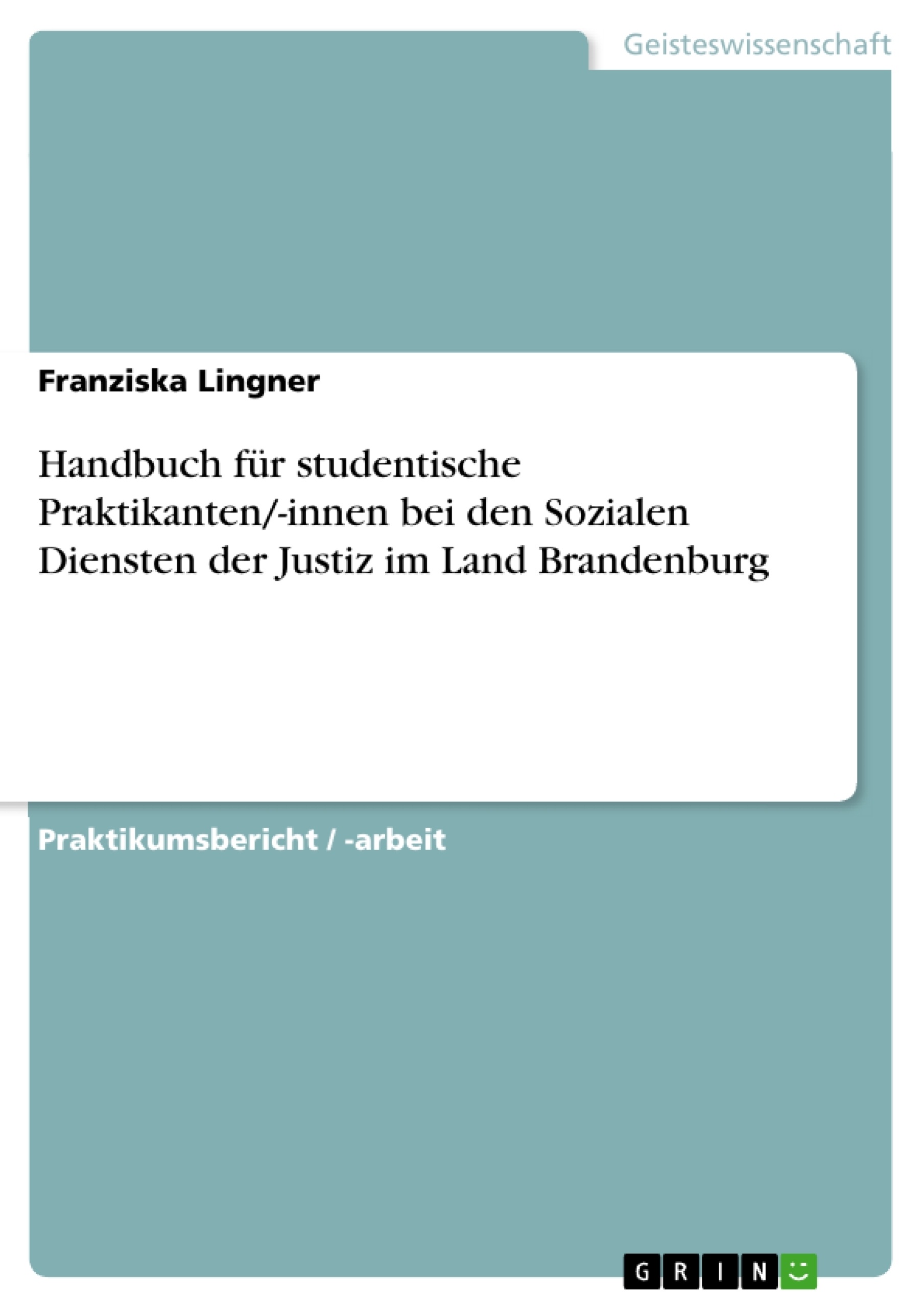Dieses Handbuch soll ein Nachschlagewerk und eine Arbeitshilfe für studentische Praktikanten/ -innen darstellen.
Es soll Praktikanten/ -innen geholfen werden, ein maßgeschneidertes, theoretisches Grundlagen-, bzw. Hintergrundwissen zu erlangen, und den Einblick in den Beruf eines Sozialarbeiters bei den Sozialen Diensten der Justiz zu konkretisieren und intensivieren. Weiter soll dieses Handbuch ein Leitfaden für Praxisanleiter/ -innen, zur Erstellung eines Ausbildungsplans und zur Verfolgung von Ausbildungszielen sein.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
1. Geschichte
1.1 Strafaussetzung zur Bewährung und Bewährungshilfe
1.2 Gerichtshilfe
1.3 Täter- Opfer- Ausgleich
1.4 Soziale Dienste der Justiz
2. Aufbau und Organisation der deutschen Justiz
2.1 Gerichtsorganisationen
2.1.1 Verfassungsgerichtsbarkeiten
2.1.1.1 Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes
2.1.1.2 Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder
2.1.2 Die ordentliche Gerichtsbarkeit
2.1.2.1 Zivilgerichtsbarkeit
2.1.2.2 Strafgerichtsbarkeit
2.1.3 Die außerordentliche Gerichtsbarkeit
2.1.3.1 Verwaltungsgerichtsbarkeit
2.1.3.2 Finanzgerichtsbarkeit
2.1.3.3 Arbeitsgerichtsbarkeit
2.1.3.4 Sozialgerichtsbarkeit
2.2 Der Strafprozess
2.2.1 Die Staatsanwaltschaft
2.2.2 Ermittlungs-, Vorverfahren
2.2.3 Zwischenverfahren
2.2.4 Hauptverfahren
2.2.5 Gerichtshilfe
2.2.6 Täter- Opfer- Ausgleich
2.3 Strafaussetzung zur Bewährung
2.3.1 Rechtsgrundlagen
2.3.2 Inhalte der Bewährungshilfe
2.2.4 Die Sozialen Dienste der Justiz im Land Brandenburg
3. Praktikum
3.1 rechtliche Grundlagen
3.1.1 Garantenpflicht
3.1.2 Schweigepflicht
3.1.3 Zeugnisverweigerungsrecht
3.1.4 Anzeigepflicht
3.1.5 Datenschutz
3.2 Dienstrechtliche Stellung des Praktikanten
Quellenverzeichnis