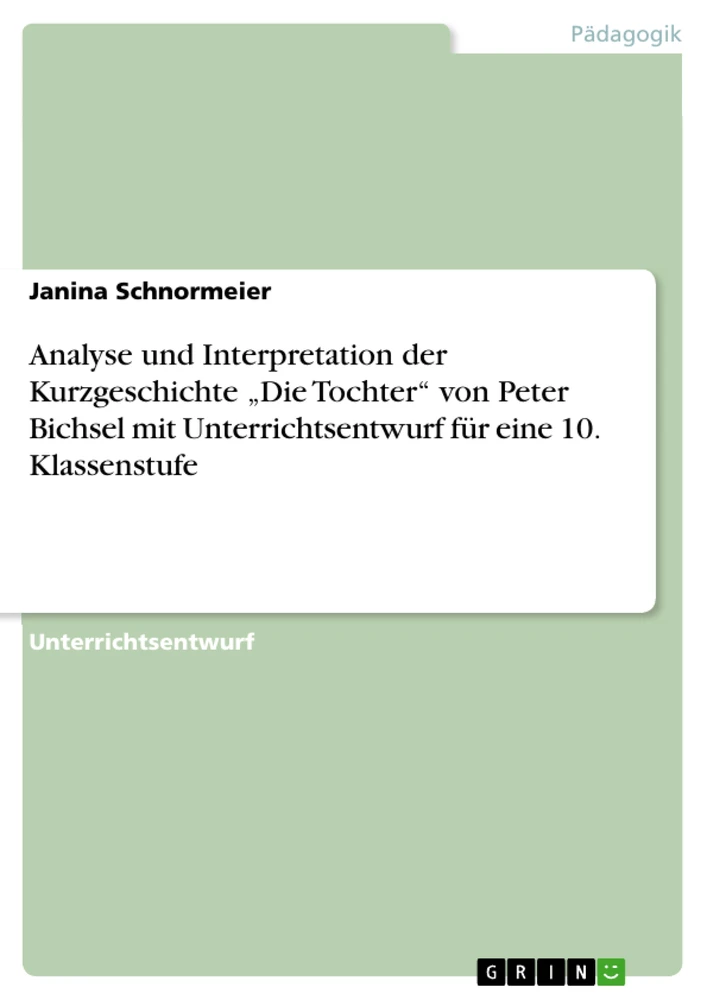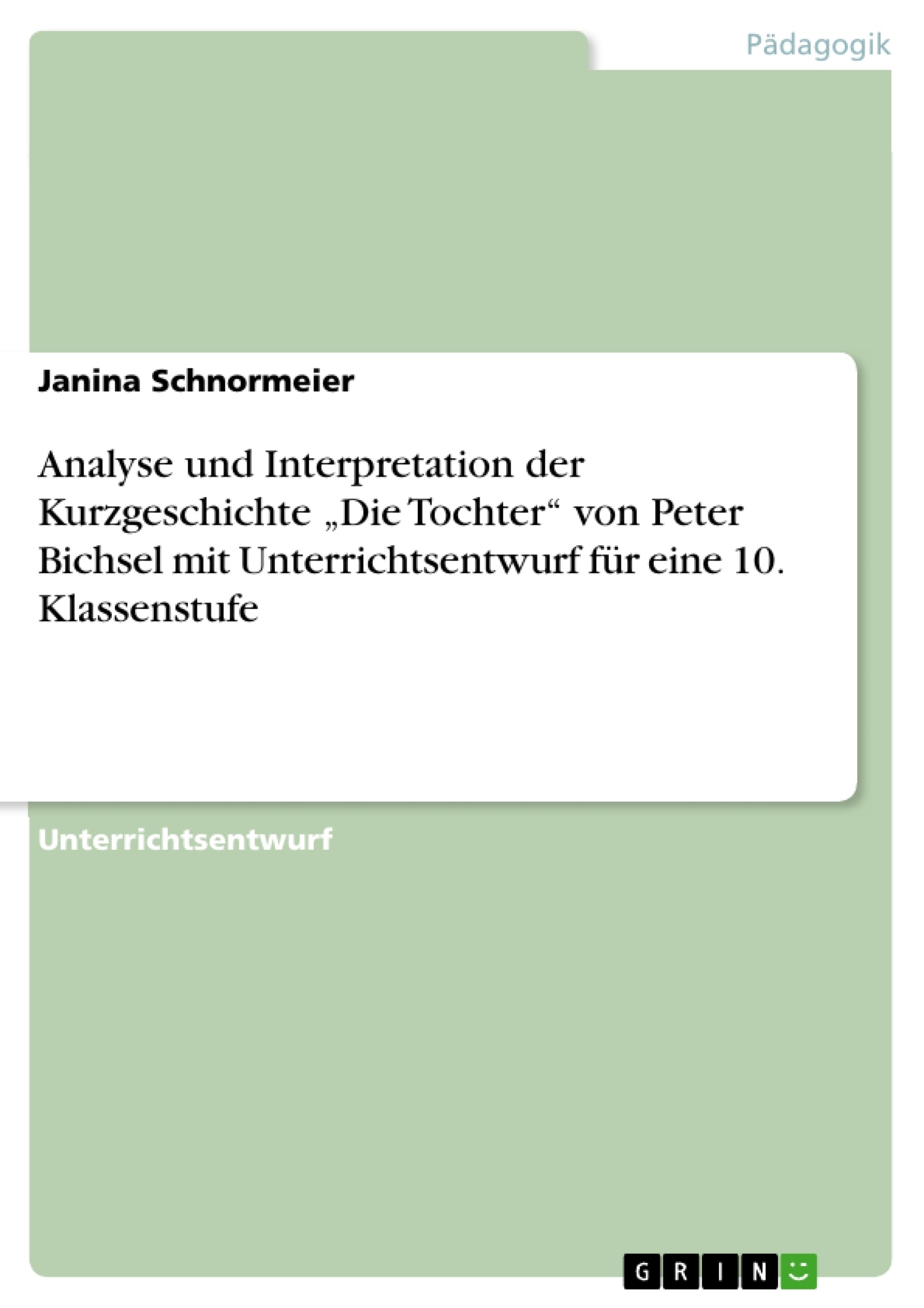In der folgenden Auseinandersetzung mit der Kurzgeschichte „Die Tochter“ möchte ich insbesondere bei der Analyse und Interpretation einige Schwerpunkte setzen, da die Kurzgeschichte ein hohes Maß an stilistischen und inhaltlichen Elementen aufweist, auf das innerhalb einer Kurz-Hausarbeit nicht vollständig eingegangen werden kann. Daher werde ich mich auf die für mich entscheidendsten und auffälligsten Merkmale der Kurzgeschichte beschränken. Diese Aspekte sollen dann auch in meinem Unterrichtsentwurf bzw. den von mir konzipierten Lernaufgaben thematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
1) Analyse und Interpretation der Kurzgeschichte „Die Tochter“ von
Peter Bichsel
2) Eignung und Attraktivität der Kurzgeschichte für die 10. Klassenstufe
3) Anzubahnendes Lernresultat
4) Lernschritte – Lernaufgaben, mit denen die Lernende das Lernresultat erreichen können
1) Beziehungsgefüge der Familienmitglieder darstellen
2) Nähere Erschließung des Textes
3) Produktionsorientierte Aufgabe
3.1) Verfassen eines Briefes
3.2) Tagebucheintrag / Innerer Monolog
3.3) Perspektivübernahme des Vaters – Gedankengang des Vaters beschreiben
3.4 ) Abändern / Fortführen der Kurzgeschichte
Anhang
Literaturverzeichnis