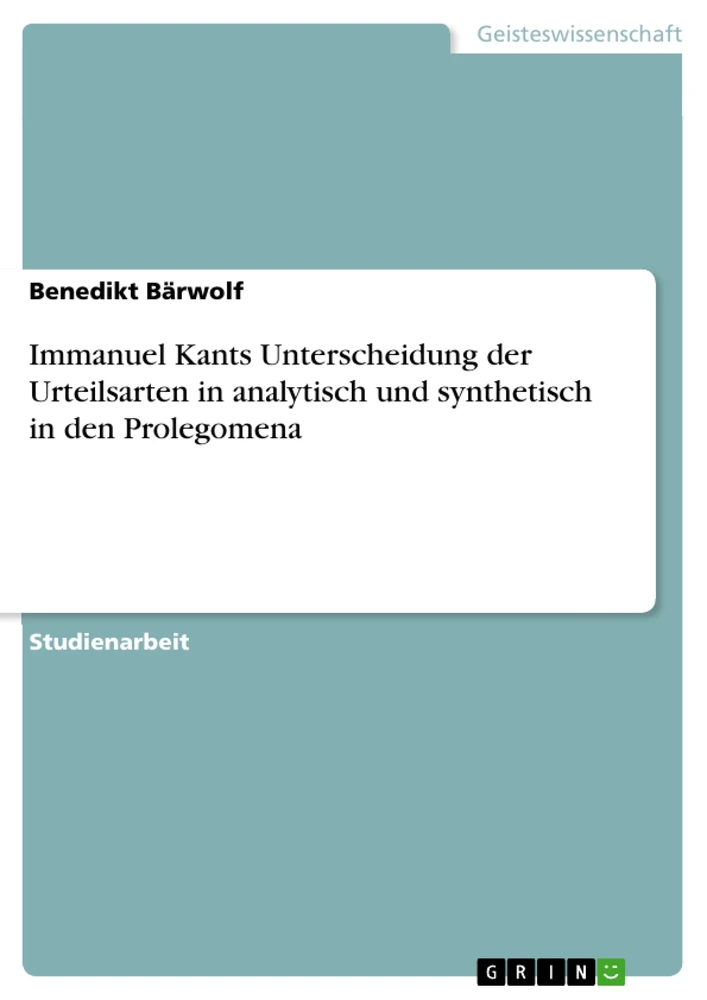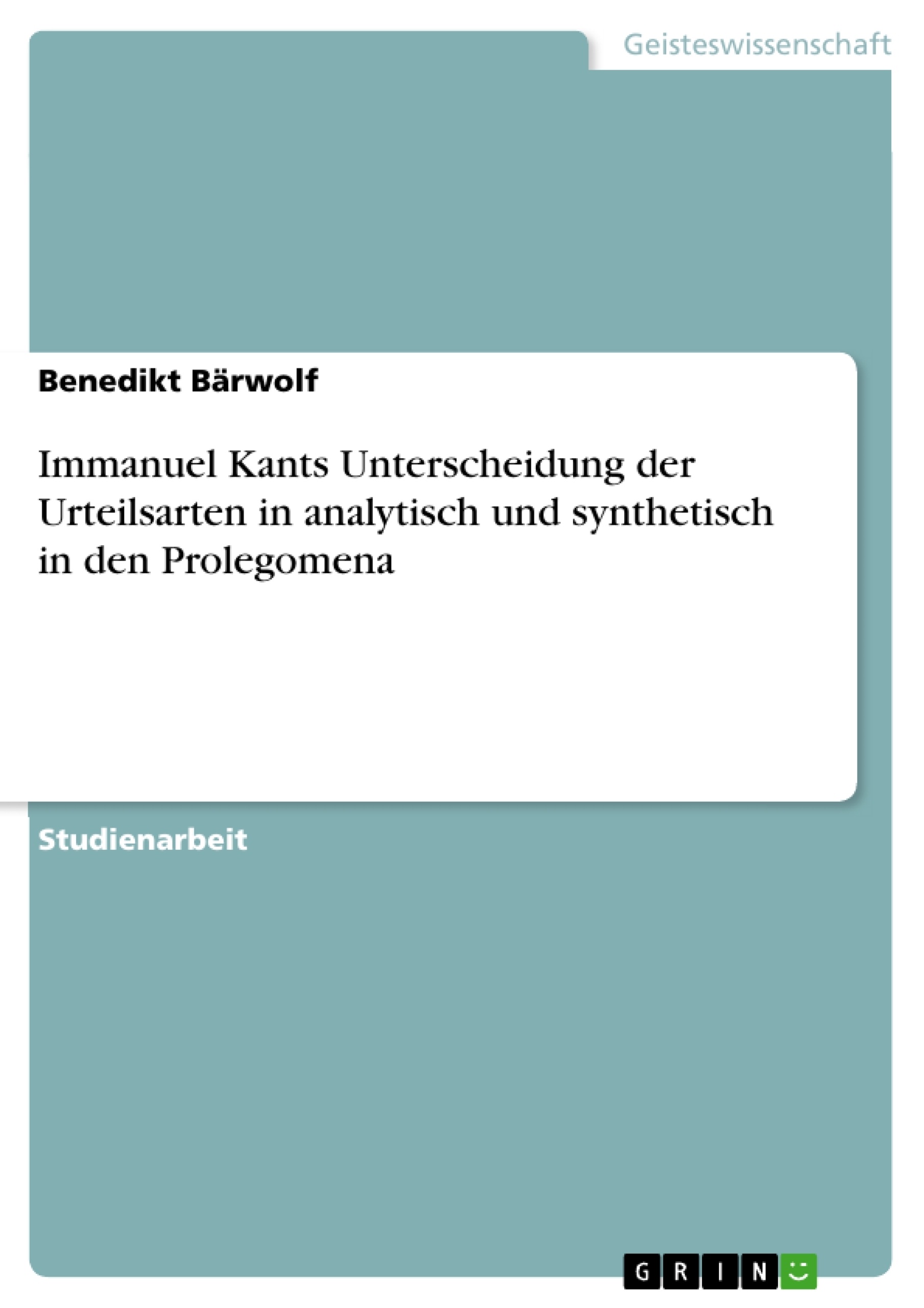„Meine Absicht ist, alle diejenigen, so es wert finden, sich mit Metaphysik zu beschäftigen, zu überzeugen: daß es unumgänglich notwendig sei, ihre Arbeit vor der Hand auszusetzen, alles bisher Geschehene als ungeschehen anzuerkennen, und vor allen Dingen zuerst die Frage aufzuwerfen: »ob auch so etwas, als Metaphysik, überall nur möglich sei«.“ Die Metaphysik, so beschreibt es Immanuel Kant in den „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“, befindet sich in einen unmöglichen Zustand. Jeder mischt sich in die Metaphysik ein und denkt sie betreiben zu können. Weiterhin tobt ein Streit zwischen dem Empirismus und dem Rationalismus, was die erste erkenntnistheoretische Frage, nach dem Ursprung der Erkenntnis, angeht. Beide philosophische Strömungen behaupten Recht zu haben. Die Empiristen sagen, dass die Quelle der menschlichen Erkenntnis eher in der Erfahrung als in der Vernunft zu Suchen sei und, dass es keine angeboren Ideen gäbe. Die Rationalisten hingegen behaupten vehement, dass den angeboren Ideen ein Dasein zugesprochen werden müsse und räumen der Vernunft einen Vorrang gegenüber der Erfahrung ein. Immanuel Kant geht nun in der „Kritik der reinen Vernunft“ und in den „Prolegomena“ der philosophischen Frage „Was kann ich wissen?“ nach und schafft mit seiner Transzendentalphilosophie eine Synthese zwischen dem Empirismus und dem Rationalismus – den wir Kritizismus nennen.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
1. Immanuel Kant und die Prolegomena – Allgemeine Vorbetrachtungen
2. Die Unterscheidung der Urteile in analytisch und synthetisch sowie a priori als auch a posteriori
a) Begriffspaar 1: a priori und a posteriori
b) Begriffspaar 2: synthetisch und analytisch
c) Die Kombinationsmöglichkeiten der zwei Begriffspaare
3. Die Hauptfragen der Prolegomena und die Frage ob es synthetische Urteile a priori geben kann
a) Wie ist reine Mathematik möglich?
b) Wie ist reine Naturwissenschaft möglich?
c) Wie ist Metaphysik überhaupt möglich?
d) Abschließende Bemerkungen zu den drei transzendentalen Hauptfragen der Prolegomena
Resümee
Literaturverzeichnis
Primärquellen
Sekundärliteratur