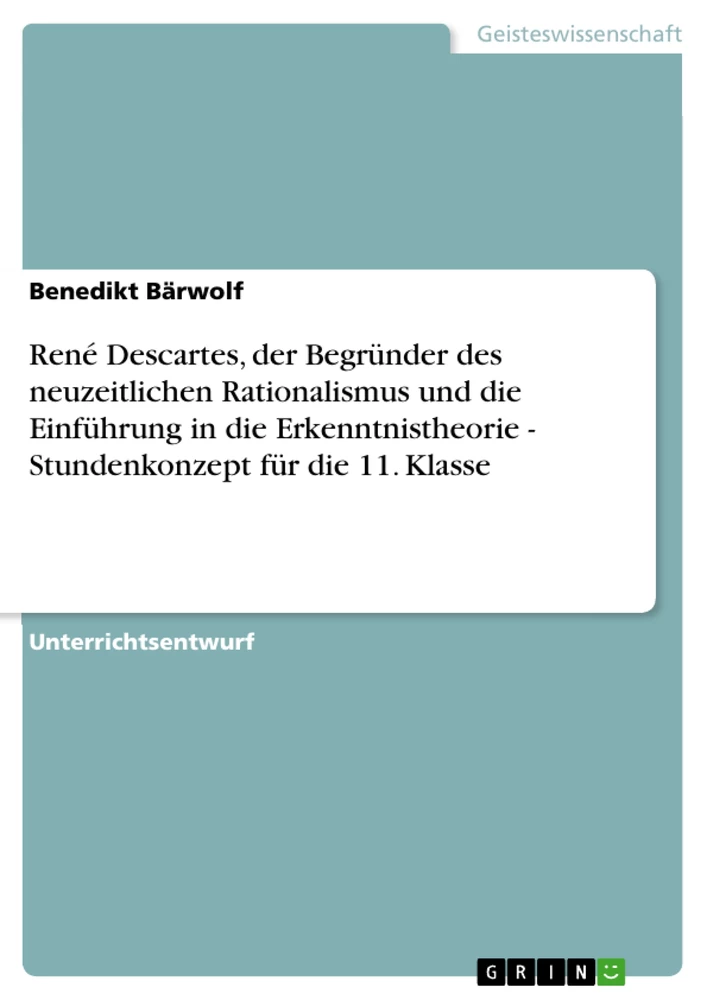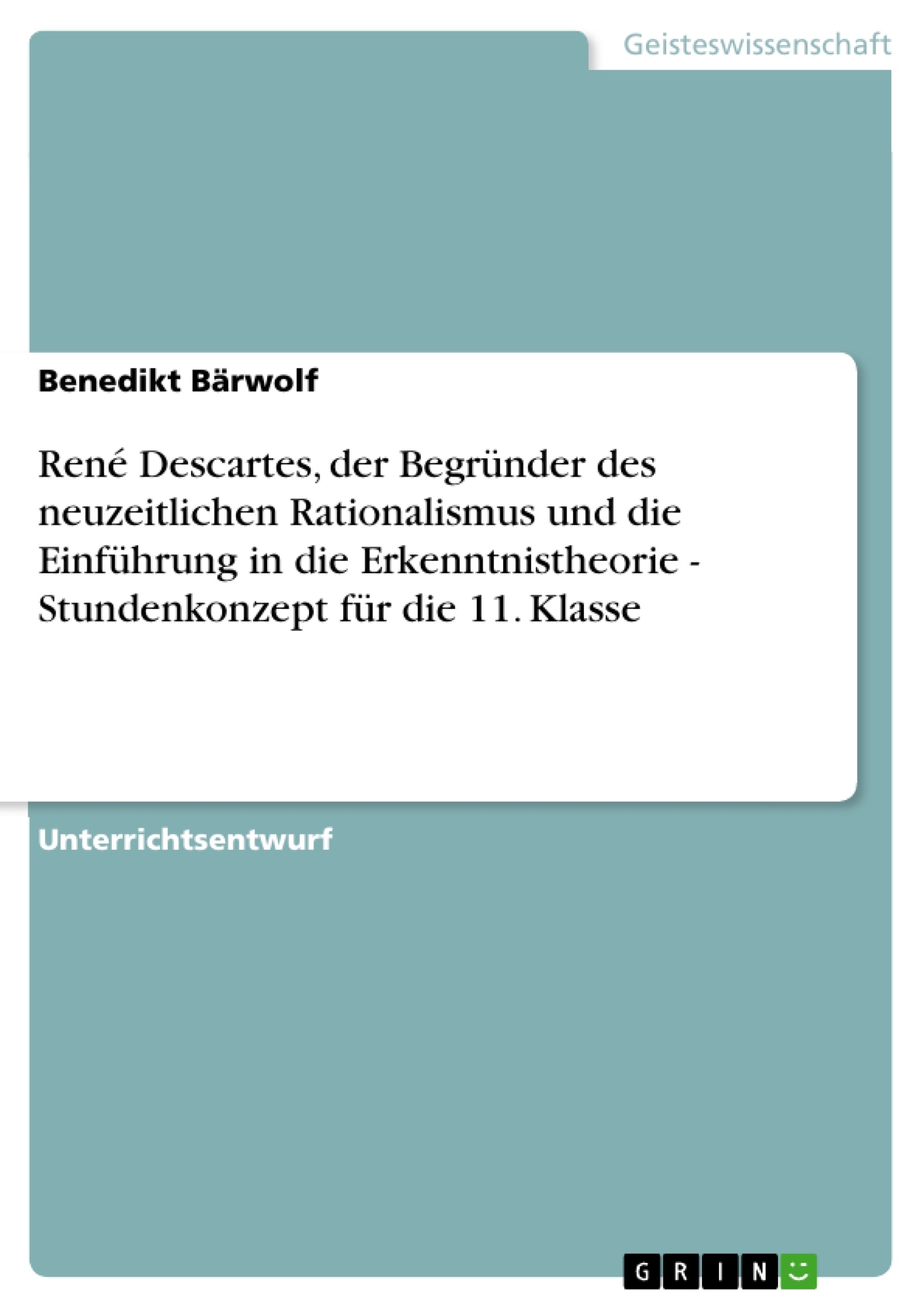Das vorliegende didaktische Unterrichtskonzept setzt sich zum Ziel die Erkenntnistheorie mit Hilfe von Descartes Meditationen den Schüler der 11. Klasse näher zu bringen. Die Schüler sollen Grundlagenwissen der Erkenntnistheorie vermittelt bekommen und lernen mit Textarbeit zu arbeiten. Dabei möchte ich mich im ersten Teil meiner Didaktikarbeit der Sachanalyse zuwenden, die zuerst eine allgemeine Einführung in die Erkenntnistheorie liefern soll. Danach werde ich systematisch die sechs Meditationen von Descartes zum Gegenstand meiner Analyse über die Erkenntnistheorie machen. Im zweiten Teil meiner Arbeit stehen die didaktischen Überlegungen zu meinen Unterrichtskonzept im Vorder-grund. Es muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass dieses Unterrichtskonzept noch theoretischer Natur ist, eine praktische Anwendung fand nicht statt. Es bleibt daher offen, welche Stellen des Unterrichtskonzepts den Schüler ansprechen werden und welche der Überarbeitung bedarf, damit die Schüler einen guten Unterricht erfahren.
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Sachanalyse
2.1 Einführung in die Erkenntnistheorie
2.1 René Descartes – Begründer der neuzeitlichen Erkenntnistheorie
2.2 Die erste Meditation – „Woran man zweifeln kann“
2.3 Die zweite Meditation – „Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er der Erkenntnis näher steht als der Körper“
2.4 Die dritte Meditation – „Über das Dasein Gottes“
2.5 Die vierte Meditation – „Über das Wahre und das Falsch“
2.6 Die fünfte Meditation - Vom Wesen der materiellen Dinge, und nochmals von der Existenz Gottes“
2.7 Die sechste Meditation - „Vom Dasein der materiellen Dinge und von der realen Verschiedenheit der Geistes vom Körper“
3. Didaktische Überlegungen
3.1 Erste Unterrichtseinheit
3.2 Zweite Unterrichtseinheit
3.3 Dritte Unterrichtseinheit
4. Schluss
Folie 1: Einführung in die Erkenntnistheorie Teil
Folie 2: Einführung in die Erkenntnistheorie Teil
Folie 3 - Übersicht über Meditationen von Descartes
Folie 4: Erste Meditation - „Woran man zweifeln kann“
Folie 5: Zweite Meditation - „Über die Natur des menschlichen Geistes; daß er der Erkenntnis näher steht als der Körper“
Descartes Dualismus
Descartes Suche nach dem Aufbau
Folie 6: Dritte Meditation - „Über das Dasein Gottes“
Folie 7: Vierte Meditation - „Über das Wahre und das Falsche“
Folie 8: Fünfte Meditation - „Vom Wesen der materiellen Dinge, und nochmals von der Existenz Gottes“
Folie 9: Sechste Meditation - „Vom Dasein der materiellen Dinge und von der realen Verschiedenheit der Geistes vom Körper“
Folie 10 René Descartes – Zeittafel
Folie 11 Descartes wichtige Werke
Anhang 1: Das erste Gedankenexperiment – „Das Gehirn in der Nährlösung“
Das erste Gedankenexperiment:
Anhang 2: Textarbeit
Anhang 3: Textarbeit
Anhang 4: Textarbeit
Anhang 5: Leistungskontrolle für die 11. Klasse
Abbildungverzeichnis
Literaturverzeichnis