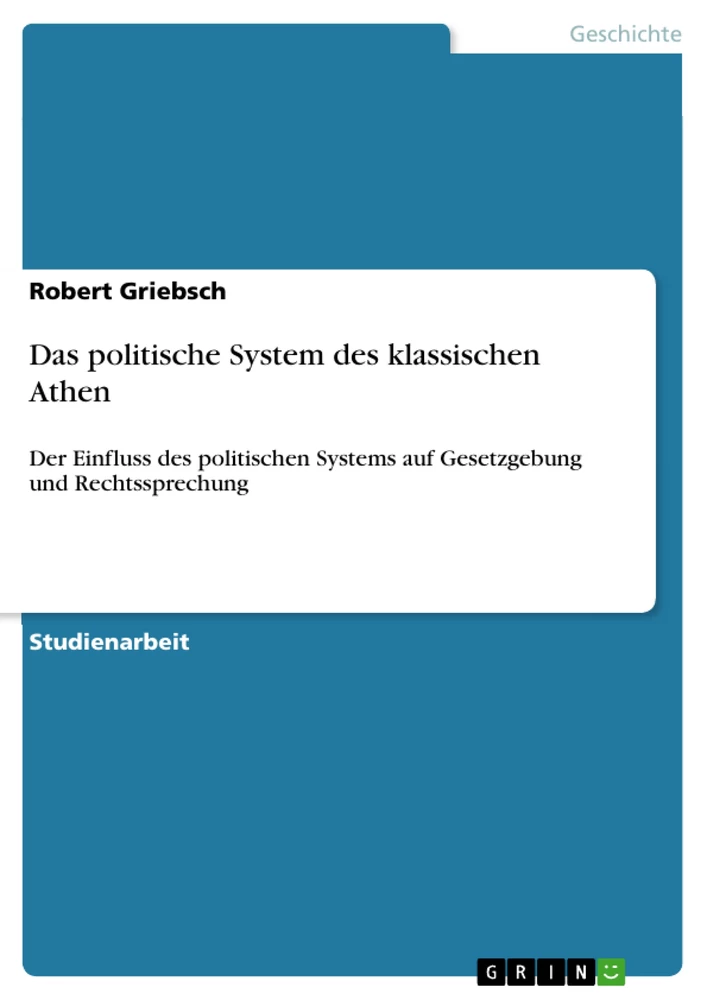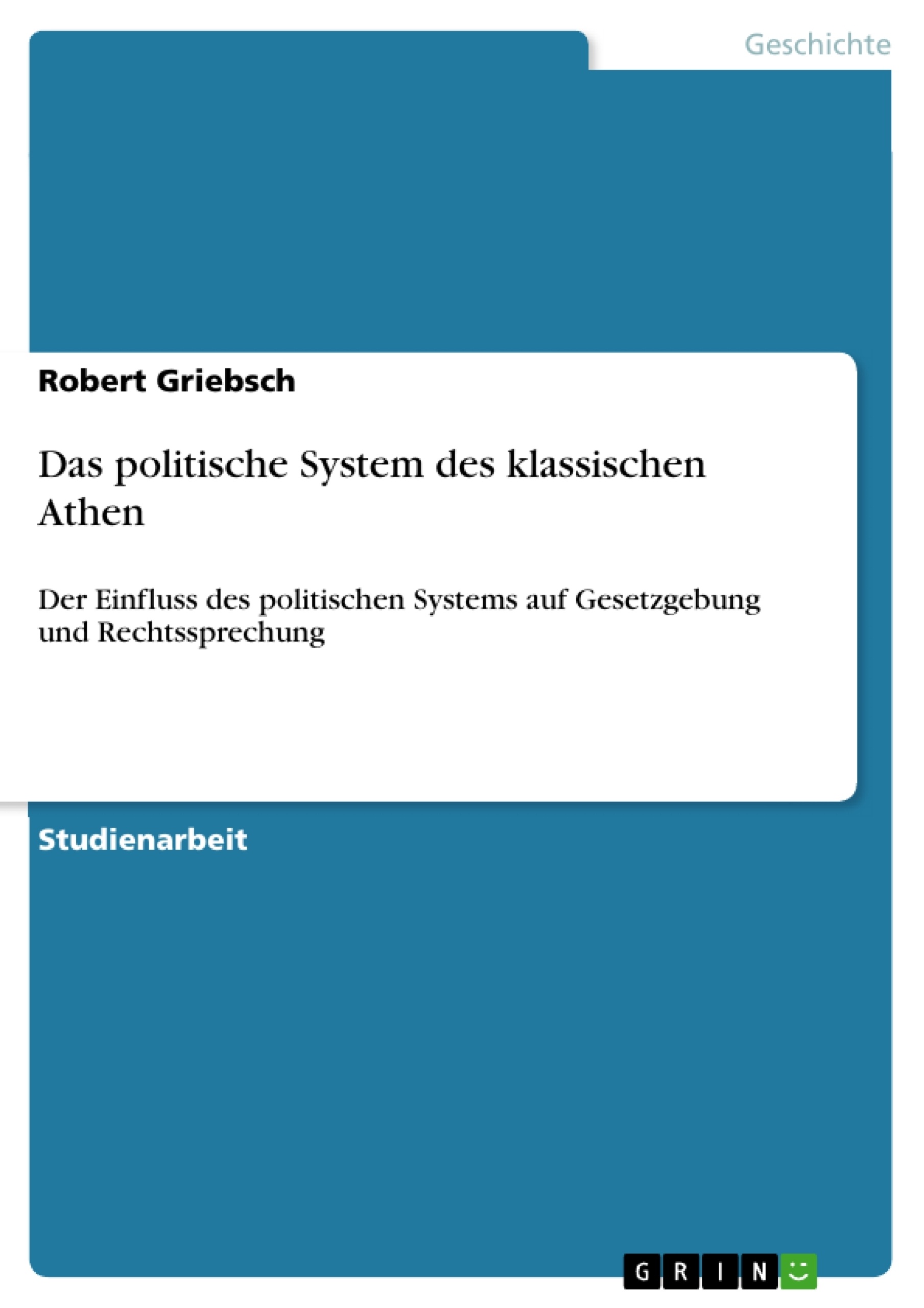Die patrios demokratia („Demokratie der Väter“) – so bezeichneten die Athener ihre Verfassung im 4. Jahrhundert v. Chr. Auch heute noch wird die attische Demokratie, unter anderem zum Vergleich mit den politischen Systemen der Gegenwart, zu Untersuchungen
heran gezogen. In den Schulen wird mit Recht bei der Analyse von demokratischen Systemen das klassische Athen als Vorläufer moderner Demokratien angesprochen. Aus diesem Grund ist es eine interessante Frage zu untersuchen, inwieweit die Demokratie in Form des
politischen Systems des klassischen Athen Einfluss auf die Gesetzgebung und Rechtssprechung nehmen konnte. Es ist die Frage, ob man solche „Gewaltenteilungen“ überhaupt in der Verfassung des klassischen Athen finden wird.
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem politischen System der attischen Demokratie zu Zeiten der Klassik (um 500-336 v. Chr.) und versucht zu klären, auf welche Art und Weise dieses politische System auf Gesetzgebung und Rechtssprechung Einfluss nehmen konnte.
Zunächst wird die Arbeit versuchen, die Phase der attischen Demokratie während der Klassik an sich zu charakterisieren. Im Anschluss sollen die Institutionen vorgestellt und in ihren
Arbeitsweisen und Funktionen kurz analysiert werden. Der Gesetzgebungsprozess, sowie der Ablauf von Gerichtsverhandlungen soll im dritten Punkt untersucht werden. In der Systematisierung soll dann versucht werden an Beispielen darzustellen, wie das politische System nun genau Einfluss auf die Rechtssprechung und Gesetzgebung Einfluss nehmen konnte.
Diese Darstellung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich an einigen prägnanten Beispielen diesen Einfluss verdeutlichen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Vorwort
1.2 Quellen und Quellenkritik
2 Die Charakteristik der attischen Demokratie
3 Die Institutionen der attischen Demokratie
3.1 Die Volksversammlung
3.2 Der Rat
3.3 Das Gerichtswesen
3.4 Die Magistrate
4 Der Prozess der Gesetzgebung und der Rechtssprechung
4.1 Der Prozess der Gesetzgebung im vierten Jahrhundert v. Chr
4.2 Der Prozess der Rechtssprechung
5 Beispiele für den Einfluss des politischen Systems
5.1 Der Ostrakismos
5.2 Die Hybris-Klage
5.3 Apagoge
5.4 Phasis
5.5 Eisangelia eis ten bulein
5.6 Eisangelia eis ton demon
6 Literaturverzeichnis