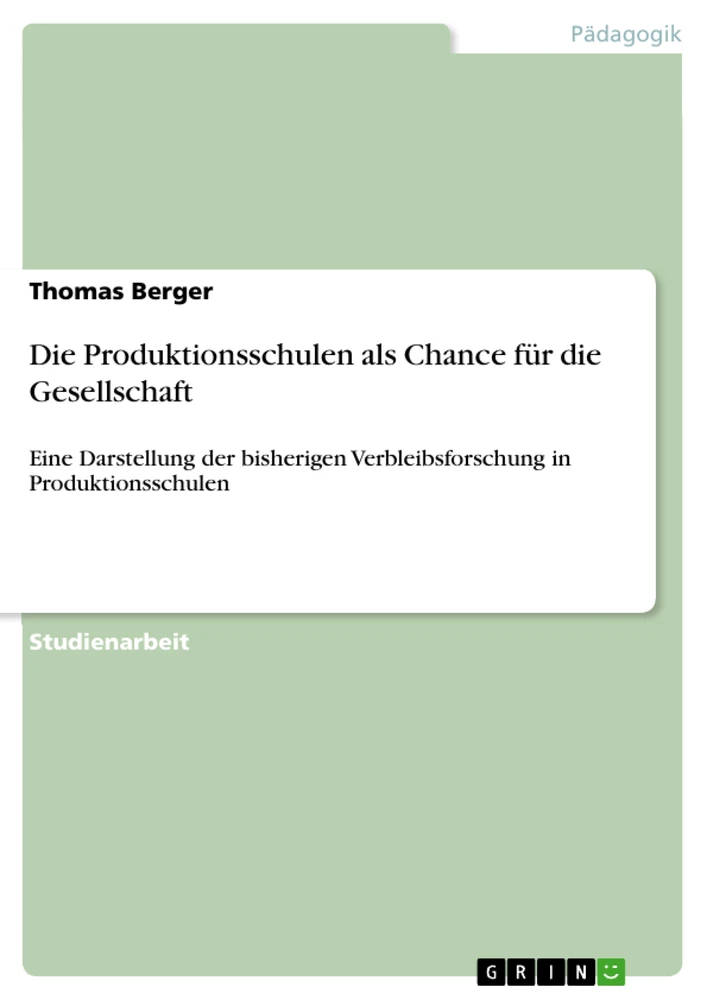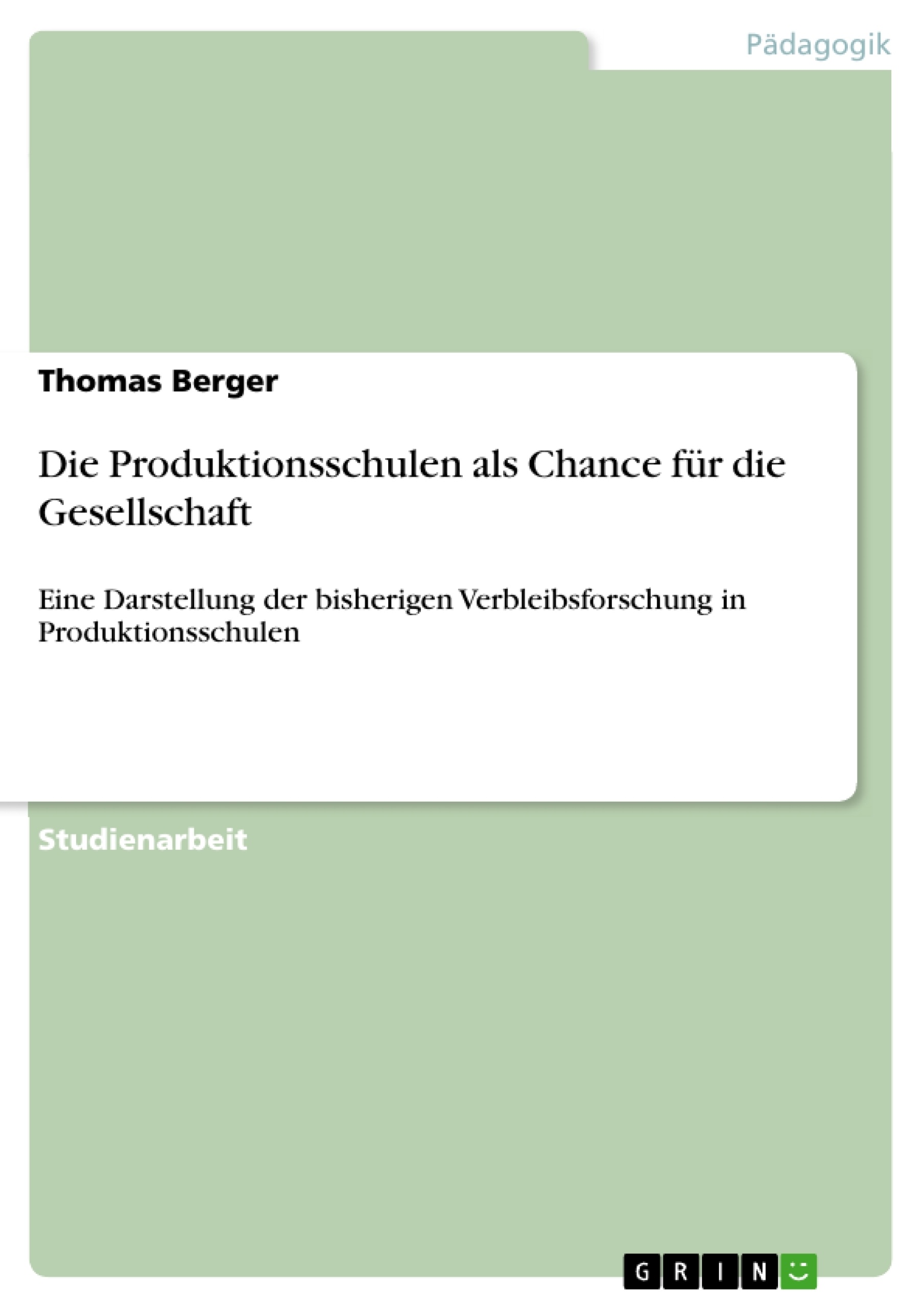Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch nicht primär mit dem Aufbau und dem Ablauf dieser Bildungsmaßnahme, sondern vielmehr mit der Dokumentation ihrer Wirkungsweise. Die Untersuchung soll sich im Schwerpunkt auf die bisherige Verbleibsforschung bezüglich der Produktionsschüler beziehen. Die bis zum heutigen Zeitpunkt durchgeführten Maßnahmen sollen dabei zunächst veranschaulicht und im Anschluss kritisch betrachtet werden. Ziel ist es, die Wichtigkeit, sowie die Chancen einer wissenschaftlich fundierten Verbleibsforschung aufzuzeigen, um basierend auf diesen Vorüberlegungen eine Forschungsarbeit zur Verbesserung der bisher getroffenen Maßnahmen anzufertigen Im folgenden Kapitel soll jedoch, der Vollständigkeit halber die Funktion und das didaktische Modell der Produktionsschulen in Deutschland kurz skizziert werden.
Dabei soll jedoch nicht das gesamte didaktische Konzept im Detail erörtert werden, sondern lediglich die Grundfunktion und die Idee der Produktionsschule erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
1.0. Einleitung
2.0. Funktion und Prinzip der Produktionsschulen
2.1. Rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen in Deutschland
3.0. Die Verbleibsforschung
3.1. Verbleibsforschung bis heute
3.2. Kritik an der bisherigen Vorgehensweise
3.3 Chancen und Risiken der Verbleibsforschung
4.0. Fazit