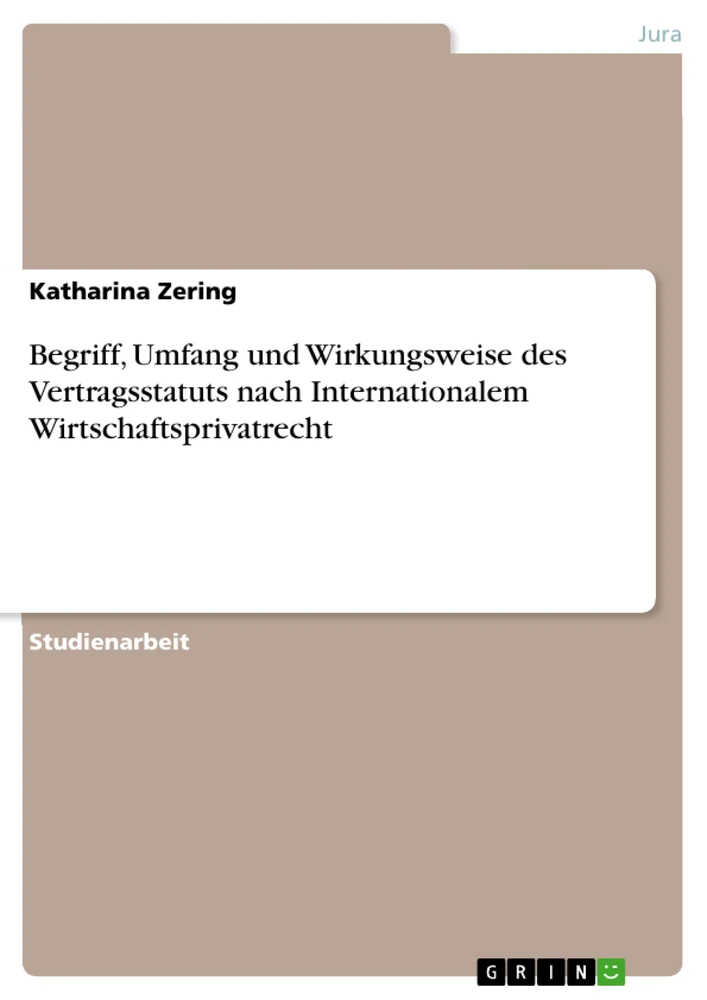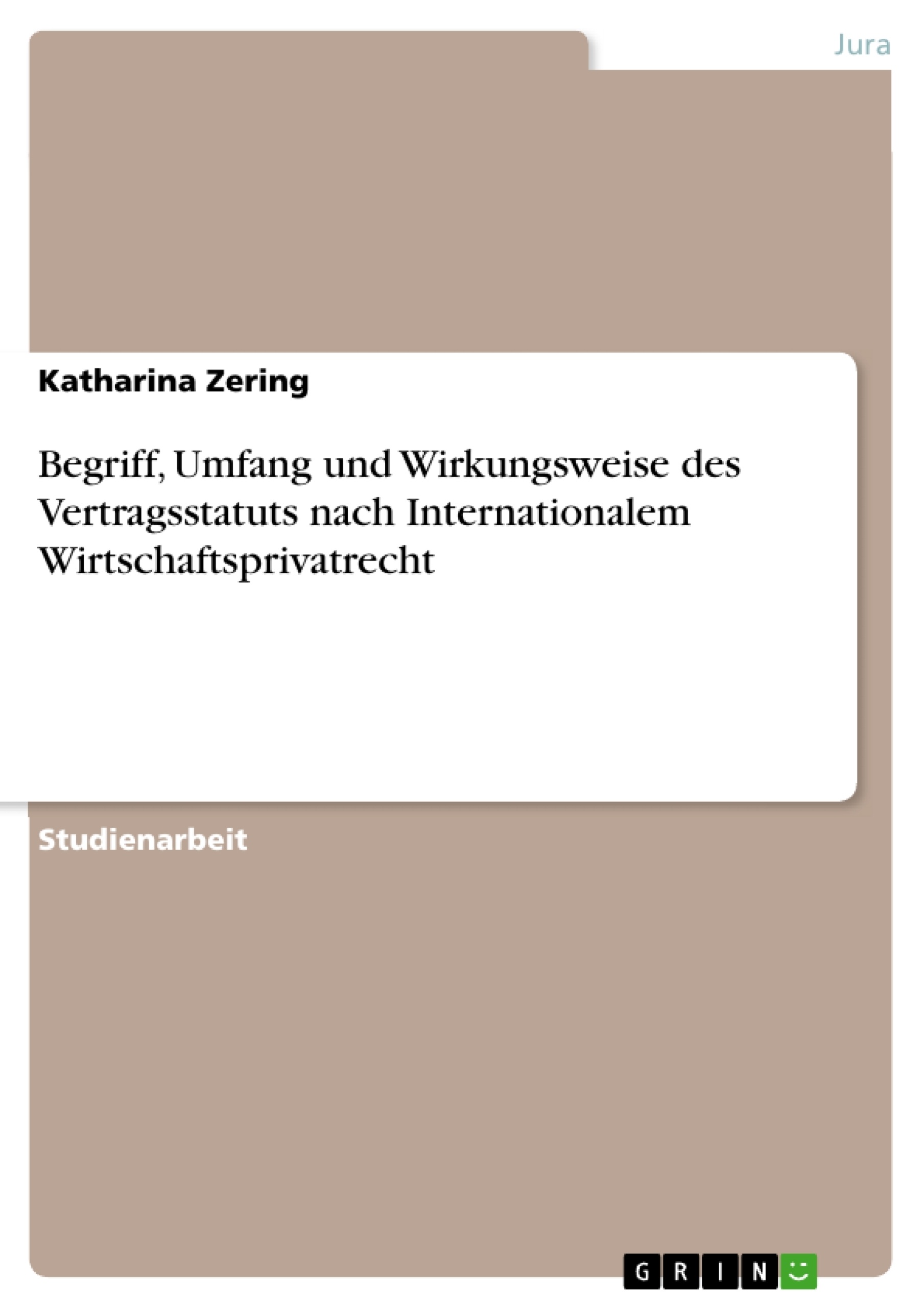Die Ausarbeitung definiert zunächst den Begriff des Vertragsstatuts im Zusammenhang zum Internationalen Wirtschaftsprivatrecht bzw. der ROM I-VO. Anschließend wird mit Hilfe der Artt. 10, 12, 17 und 18 ROM I-VO der Umfang des anwendbaren Rechts abgegrenzt. Schlussfolgernd findet im dritten Abschnitt die Erläuterung der Wirkungsweise und der mit einhergehenden Schranken statt.
Der Anhang bietet zur Erläuterung einen Glossar mit internationalrechtlichen Begrifflichkeiten und eine Synopse zwischen der ROM I-VO, der EVÜ und dem EGBGB.
Zielsetzung der Abhandlung ist die Sensibilisierung für die Thematik, um noch vor der Vertragsgestaltung Kollisionsrisiken zu erkennen und den Vertrag so zu gestalten, dass Pflichten genau eingehalten und rechtliche Risiken, z.B. mit Hilfe einer ausdrücklichen Rechtswahl, minimiert werden.
Abkürzungsverzeichnis
1. Einführung und Zielsetzung der Abhandlung
2. Begriff des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
2.1. Internationales Wirtschaftsprivatrecht
2.2. Begriff Vertragsstatut
2.3. ROM I-VO
2.3.1. Sachlicher Anwendungsbereich
2.3.2. Universelle Anwendung
2.3.3. Zeitlicher Anwendungsbereich
3. Umfang des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
3.1. Zustandekommen und Wirksamkeit des Vertrages (Art. 10 ROM I-VO)3.2. Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts (Art. 12 ROM I-VO)3.2.1. Auslegung (Art. 12 Abs. 1 a ROM I-VO) - 2 -
3.2.2. Erfüllung von Verpflichtungen (Art. 12 Abs. 1 b ROM I-VO)3.2.3. Folgen der Nichterfüllung von Verpflichtungen (Art. 12 Abs. 1 c ROM I-VO)
3.2.4. Erlöschen des Schuldverhältnissen und Folgen des Zeitablaufs(Art. 12 Abs. 1 d ROM I-VO)
3.2.5. Folgen der Nichtigkeit des Vertrages (Art. 12 Abs. 1 e ROM I-VO)
3.2.6. Art und Weise der Erfüllung (Art. 12 Abs. 2 ROM I-VO)
3.2.7. Beweislast (Art. 18 ROM I-VO)
4. Wirkungsweise des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
4.1. Subjektive Anknüpfung (Art. 3 ROM I-VO)
4.2. Objektive Anknüpfung (Art. 4 ROM I-VO)
4.2.1. Auffangklausel (Art. 4 Abs. 2 ROM I-VO)
4.2.2. Ausweichklausel (Art. 4 Abs. 3 ROM I-VO)
4.2.3. Generalklausel (Art. 4 Abs. 4 ROM I-VO)
4.3. Ausschluss der Rück- und Weiterverweisung (Art. 20 ROM I-VO)4.4. Schranken der Wirkungsweise
4.4.1. Ordre public (Art. 21 ROM I-VO)
4.4.2. Eingriffsnormen (Art. 9 ROM I-VO)
5. Fazit
Anhang
Quellenverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abkurzungsverzeichnis
1. Einfuhrung und Zielsetzung der Abhandlung
2. Begriff des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
2.1. Internationales Wirtschaftsprivatrecht
2.2. Begriff Vertragsstatut
2.3. ROM I-VO
2.3.1. Sachlicher Anwendungsbereich
2.3.2. Universelle Anwendung
2.3.3. Zeitlicher Anwendungsbereich
3. Umfang des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
3.1. Zustandekommen und Wirksamkeit des Vertrages (Art. 10 ROM I-VO)
3.2. Geltungsbereich des anzuwendenden Rechts (Art. 12 ROM I-VO)- 4 -
3.2.1. Auslegung (Art. 12 Abs. 1 a ROM I-VO)
3.2.2. Erfullung von Verpflichtungen (Art. 12 Abs. 1 b ROM I-VO)
3.2.3. Folgen der Nichterfullung von Verpflichtungen (Art. 12 Abs. 1 c ROM I-VO)
3.2.4. Erloschen des Schuldverhaltnissen und Folgen des Zeitablaufs (Art. 12 Abs. 1 d ROM I-VO)
3.2.5. Folgen der Nichtigkeit des Vertrages (Art. 12 Abs. 1 e ROM I-VO)
3.2.6. Art und Weise der Erfullung (Art. 12 Abs. 2 ROM I-VO)
3.2.7. Beweislast (Art. 18 ROM I-VO)
4. Wirkungsweise des Vertragsstatuts nach Internationalem Wirtschaftsprivatrecht
4.1. Subjektive Anknupfung (Art. 3 ROM I-VO)
4.2. Objektive Anknupfung (Art. 4 ROM I-VO)
4.2.1. Auffangklausel (Art. 4 Abs. 2 ROM I-VO)
4.2.2. Ausweichklausel (Art. 4 Abs. 3 ROM I-VO)
4.2.3. Generalklausel (Art. 4 Abs. 4 ROM I-VO)
4.3. Ausschluss der Ruck- und Weiterverweisung (Art. 20 ROM I-VO)
4.4. Schranken der Wirkungsweise
4.4.1. Ordre public (Art. 21 ROM I-VO)
4.4.2. Eingriffsnormen (Art. 9 ROM I-VO)
5. Fazit
Anhang
Quellenverzeichnis