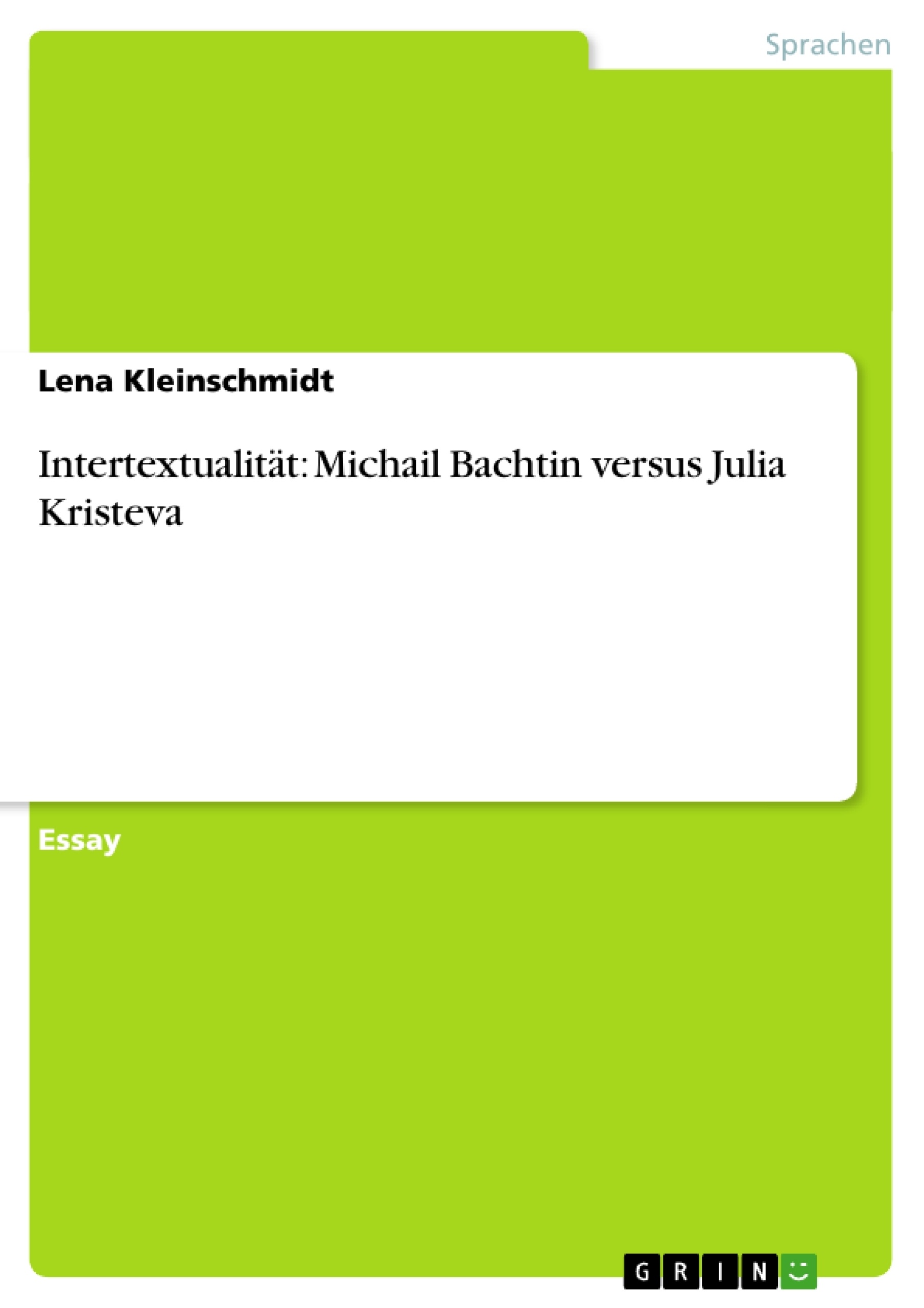Essay I: Michail Bachtin versus Julia Kristeva
Der Terminus Intertextualität entwickelte sich ab 1967 mit Julia Kristevas Aufsatz „Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman“. Ziel meines Essays soll es sein mit Michail Bachtin, als dessen
geistige Erbin man Kristeva betrachtet, die Ursprünge und zugleich die Entwicklung des Intertextualitätsbegriffs bei Kristeva näher zu beleuchten, sowie beide Positionen vergleichend zu analysieren.
Michail Bachtin entwickelte seinen Studien unter dem Titel „Das Wort im Roman“ beginnend um 1920, setzte seine Ausführungen jedoch in den darauf folgenden Jahren fort. Er entwickelte seine Theorie aus Überlegungen zu dem Zusammenhang von Literatur und Gesellschaft. Dabei unterscheidet er die beiden Prinzipien der Monologizität (hochsprachlicher Homogenisierung) und der Dialogizität.
Der von ihm geprägte Terminus der Dialogizität, der für zukünftige Intertextualitätsstudien prägend werden soll, entwickelte sich aus der Suche nach einer klaren Stilistik des Romans. Bisher war die
Auffassung vorherrschend das Romanwort sei ein künstlerisch neutrales Kommunikationsmittel. Doch in Bachtins Überlegungen fußte die Ansicht, dass der Roman als Ganzes viele Stile,
verschiedenartige Reden, sowie Stimmen beinhalte d.h. das Romanwort konstituiere sich aus heterogenen stilistischen Einheiten, die auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen und nach unterschiedlichen stilistischen Gesetzmäßigkeiten folgen. [...]
Intertextualität: Michail Bachtin versus Julia Kristeva
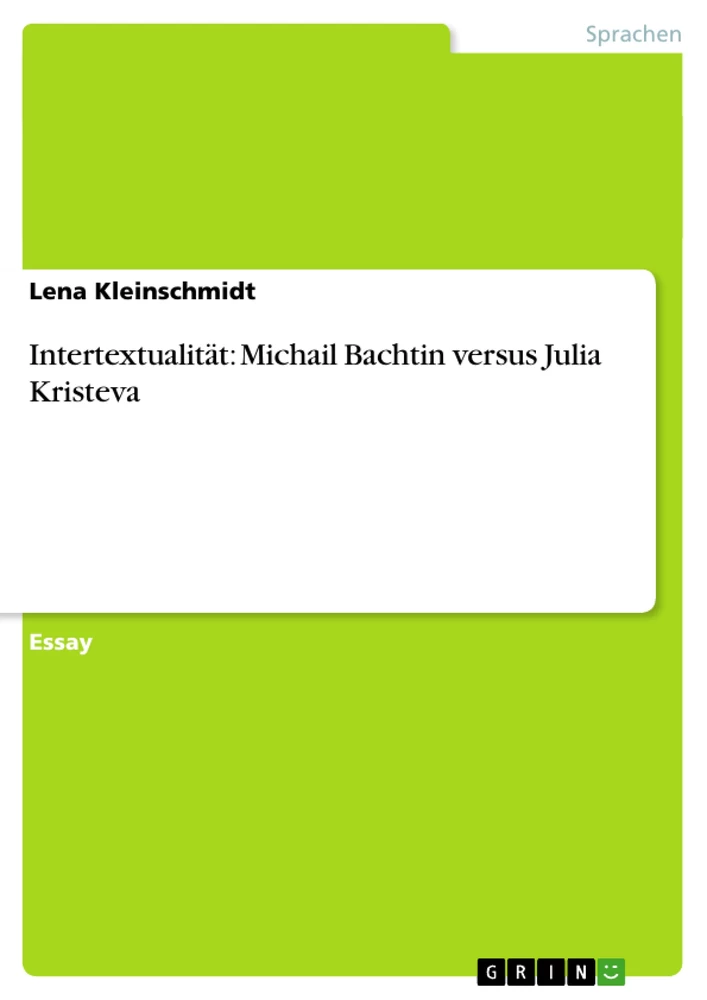
Essay , 2010 , 4 Seiten , Note: 1,7
Autor:in: Lena Kleinschmidt (Autor:in)
Literaturwissenschaft - Vergleichende Literaturwissenschaft
Leseprobe & Details Blick ins Buch