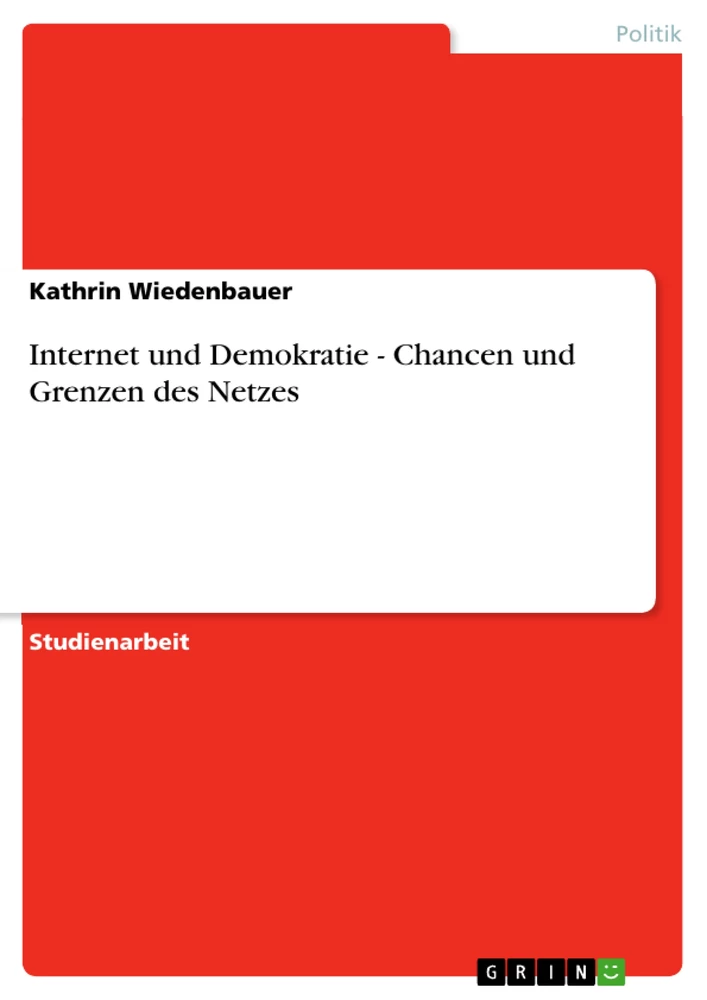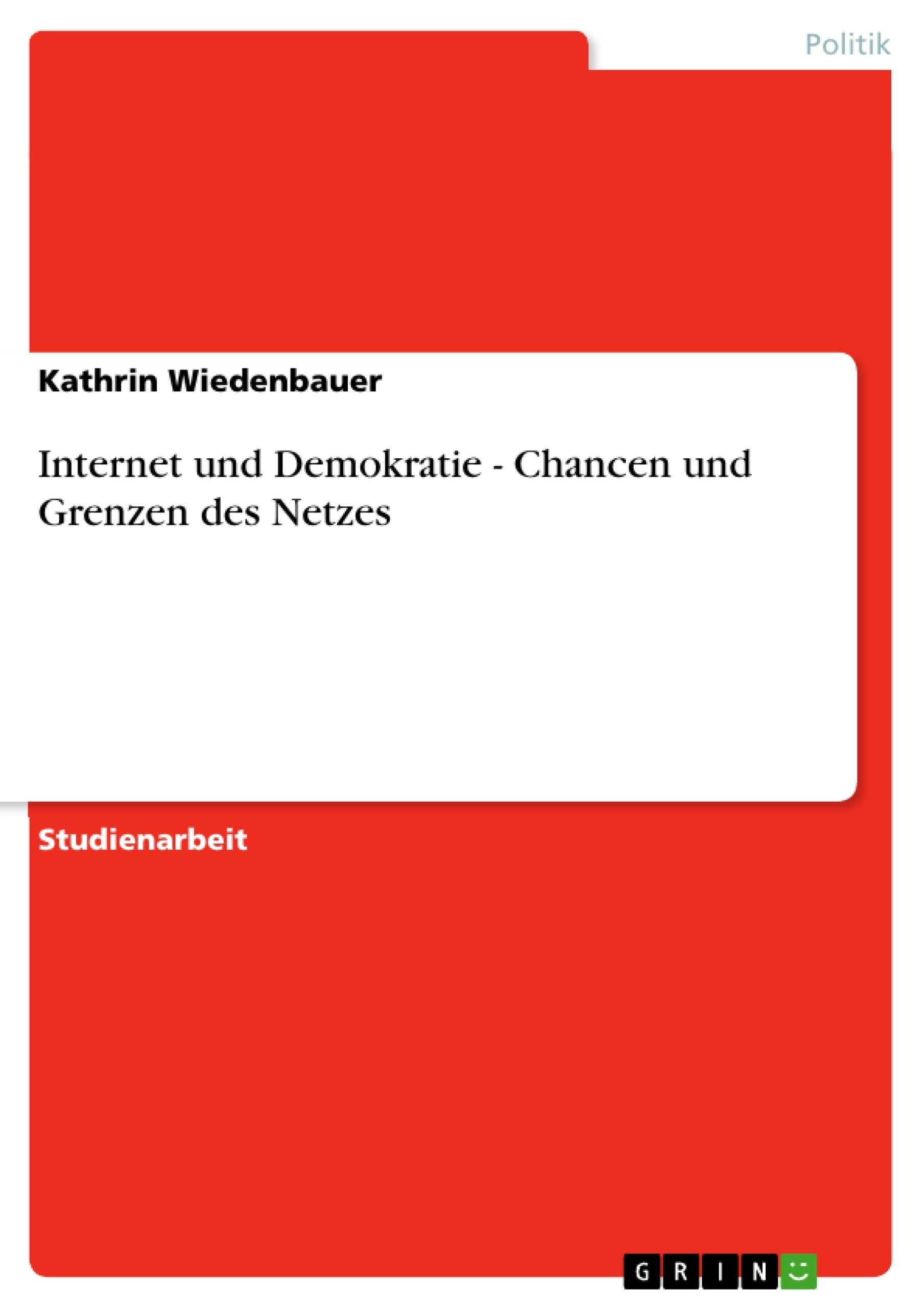Das Internet als Medium zur politischen Kommunikation schafft zusätzliche Möglichkeiten zum direkten Dialog zwischen Bevölkerung und politischen Akteuren und vereinfacht somit den Kontakt.
In Bezug auf Wahlen und Abstimmungen oder auf politische Kampagnen lässt sich das Internet für direkte Mobilisierung, breite Selbstdarstellung und für die gezielte Ansprache von Zielgruppen nutzen. Es können politische Aktionen vernetzt und alternative Beteiligungsformen gefördert werden.
Neben all diesen demokratieförderlichen Potential birgt das Internet auch Krisenpotential, das nicht außer acht gelassen werden sollte.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem stellen die zusätzlichen Missbrauchs- und Manipulationsmöglichkeiten dar. So ist z.B. die Urheberschaft einer Falschmeldung im Netz nicht ohne weiteres nachvollziehbar.
GLIEDERUNG
1. EINLEITUNG
2. DIE POLITISCHE ORGANISATION DES INTERNET
3. ROLLE DER MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
3.1. Einfluss des Internet auf das Verhältnis Medien und Demokratie
4. DAS DEMOKRATISCHE POTENTIAL DES INTERNET
4.1. Chancen und Grenzen des Internet
4.2. Potential des Internet zur politischen Partizipation
4.3. Politische Kommunikation
4.3.1. Akteure politischer Netzkommunikation
4.3.2. Veränderung von Kommunikationsstrukturen
4.3.3. Spaltung politischer Kommunikation
5. POLITISCHE BILDUNG IM ZEITALTER ELEKTRONISCHER MASSENKOMMUNIKATION
6. BIBLIOGRAPHIE