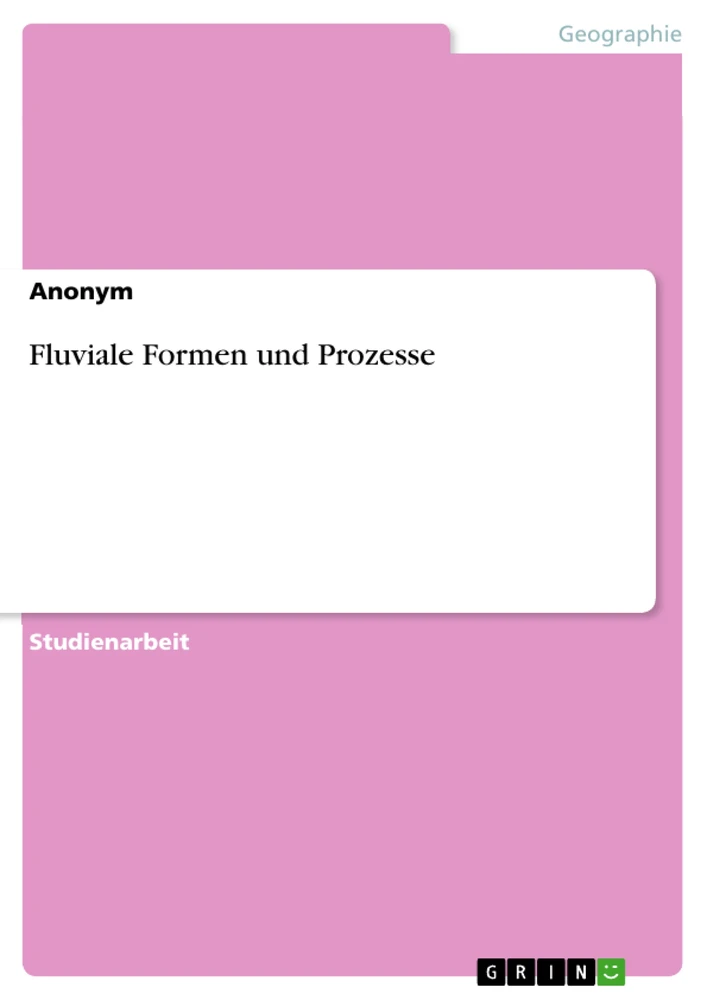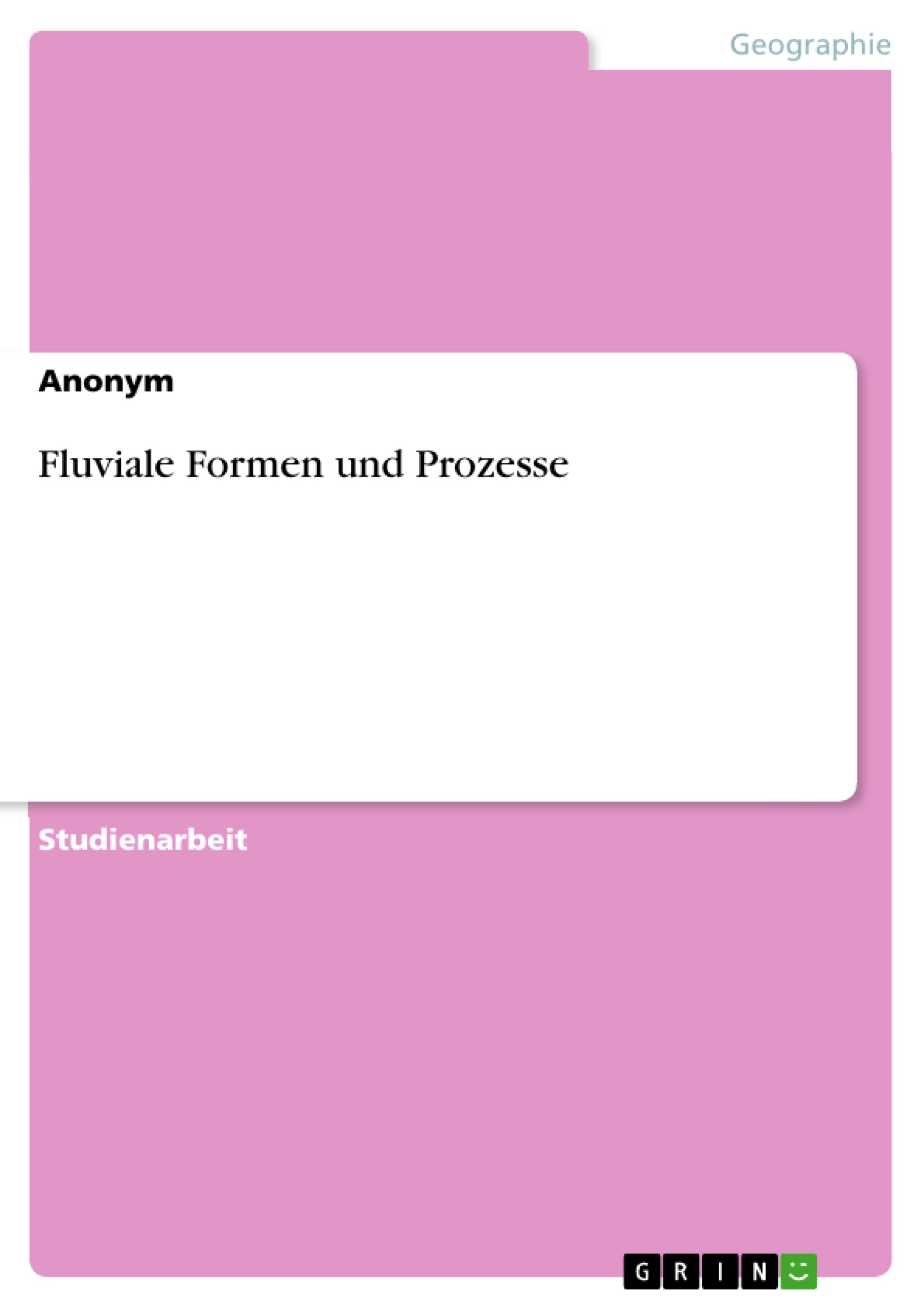Fluviale Prozesse und Formen bilden bei der Reliefgestaltung ausschlaggebende Faktoren. Die folgende Arbeit möchte die Fluvialmorphologie näher erläutern und beginnt mit allgemeinen Grundlagen der Fluvialmorphologie, die zum besseren Verständnis der Prozesse und Formen dienen soll. Nach Vorstellung allgemeiner Grundlagen wird im dritten Kapitel näher auf die physikalischen Grundlagen eingegangen, wobei einige Formeln besprochen werden. Im anschließenden vierten Kapitel werden fluviale Prozesse vorgestellt und beschrieben. Im fünften Kapitel dieser Arbeit werden fluviale Formen behandelt und dargestellt.
1. Einleitung
2. Allgemeine Grundlagen zur Fluvialmorphologie
2.1. Begriffe aus der Flusskunde
2.2. Klassifikation von Fließgewässer
2.3. Flusslängsprofil
2.4. Flussklassifikation
2.5. Flussordnungszahl
2.6. Flussdichte, Taldichte und Gabelungsverhältnis
2.7. Grundriss von Fließgewässer
2.8. Globaler Wasserhaushalt
2.9. Der Wasserkreislauf
2.10. Allgemeine Wasserhaushaltsgleichung
2.11. Abflussganglinie und Abflussregime
3. Physikalische Grundlagen zur Fluvialmorphologie
3.1. Fließart und Fließgeschwindigkeit
3.2. Die mittlere Fließgeschwindigkeit
3.3. Der hydraulische Radius
3.4. Der Abfluss
3.5. Die Schubspannung
4. Fluviale Prozesse
4.1. Erosion
4.2. Transport
4.3. Akkumulation
5. Fluviale Formen
5.1. Grundrissmuster von Flussnetzen
5.2. Idealtypische Talformen
5.3. Fluviale Akkumulationsformen
6. Fazit
Inhalt
1.Einleitung
2.Allgemeine Grundlagen zur Fluvialmorphologie
2.1. Begriffe aus der Flusskunde
2.2. Klassifikation von Fließgewässer
2.3. Flusslängsprofil
2.4. Flussklassifikation
2.5. Flussordnungszahl
2.6. Flussdichte, Taldichte und Gabelungsverhältnis
2.7. Grundriss von Fließgewässer
2.8. Globaler Wasserhaushalt
2.9. Der Wasserkreislauf
2.10. Allgemeine Wasserhaushaltsgleichung
2.11.Abflussganglinie und Abflussregime
3. Physikalische Grundlagen zur Fluvialmorphologie
3.1. Fließart und Fließgeschwindigkeit
3.2. Die mittlere Fließgeschwindigkeit
3.3. Der hydraulische Radius
3.4. Der Abfluss
3.5. Die Schubspannung
4. Fluviale Prozesse
4.1. Erosion
4.2. Transport
4.3. Akkumulation
5. Fluviale Formen
5.1. Grundrissmuster von Flussnetzen
5.2. Idealtypische Talformen
5.3. Fluviale Akkumulationsformen
6. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis