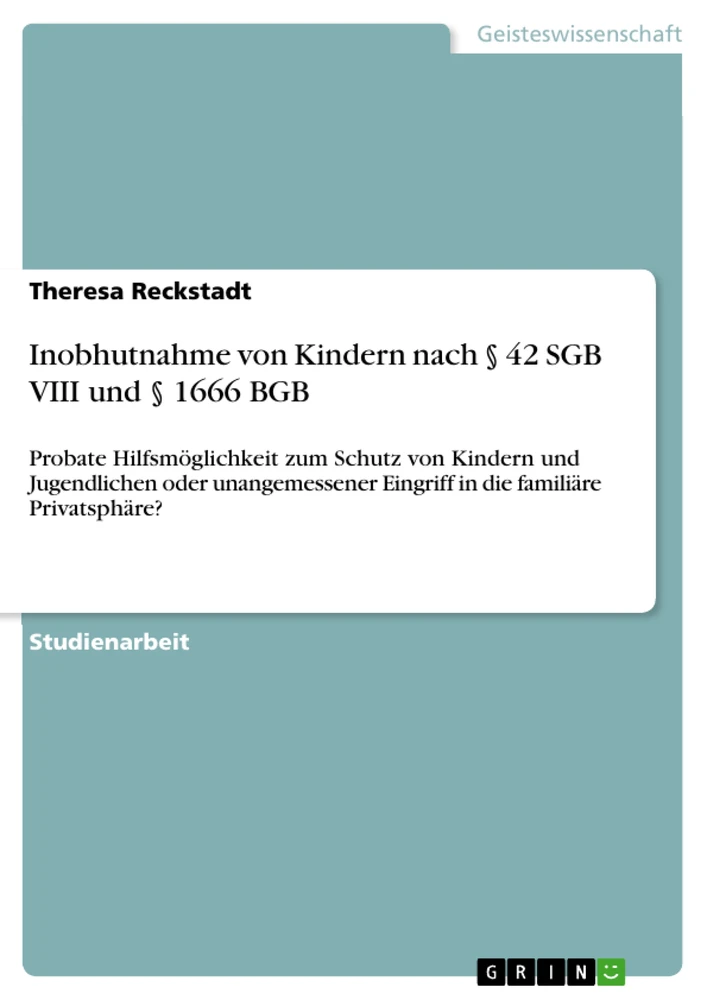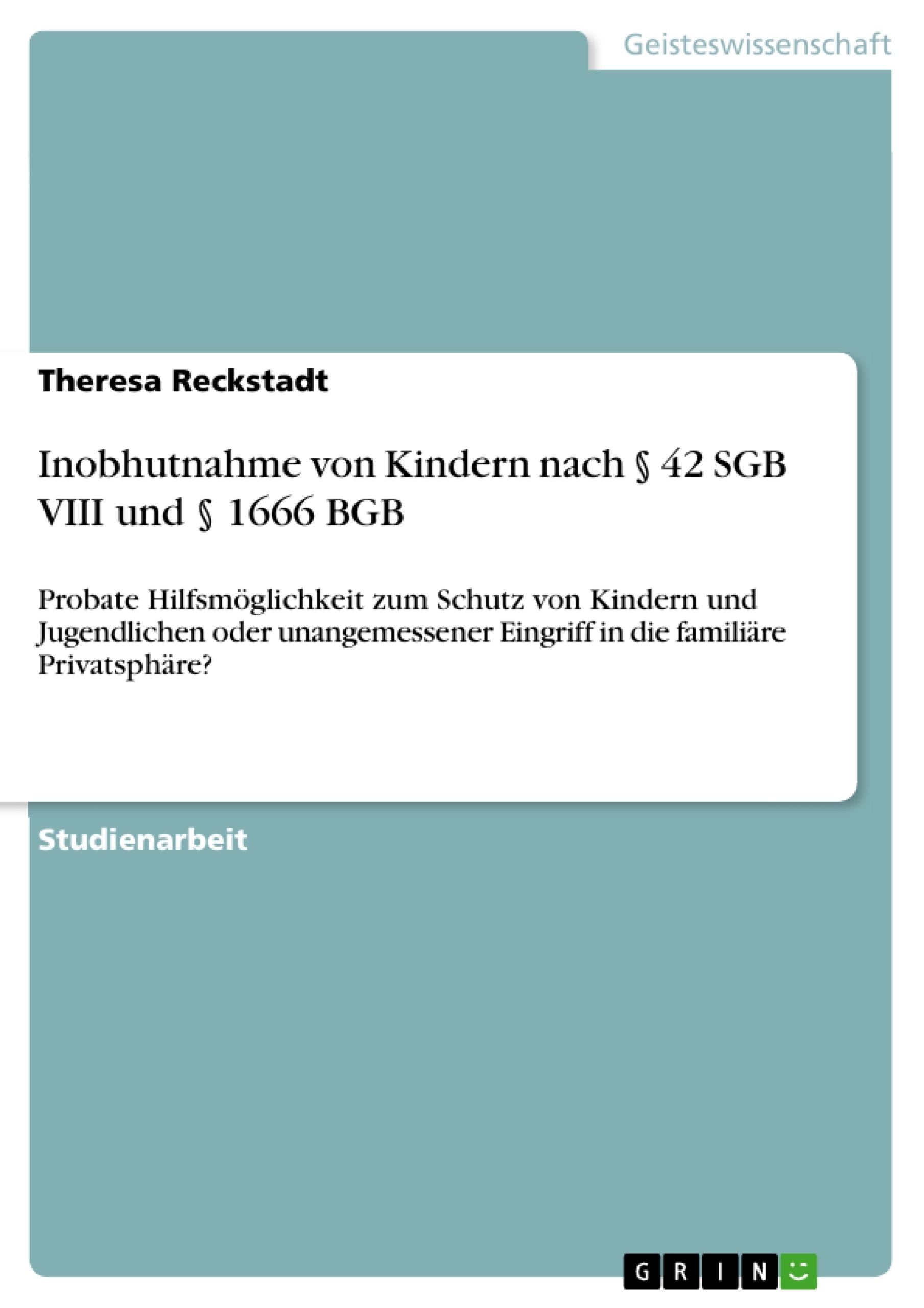Die Sichtweise, dass es sich bei Inobhutnahmen meist um einen unangemesse-nen Eingriff in die Privatsphäre von Familien handelt, ist weit verbreitet. Mit dieser Meinung geht vermutlich oft die Annahme einher, dass Kinder grundsätzlich bei ihren Eltern am besten aufgehoben seien da diese besser als alle anderen auf deren Bedürfnisse eingehen können. Es kommt jedoch immer wieder vor, dass Jugendämter in ihnen bereits bekannten Familien eine massive Kindeswohlge-fährdung durch die Erziehungsberechtigten nicht erkannt und daher auch nicht in Form einer Inobhutnahme eingegriffen haben, was sich - nachdem es zu starken Misshandlungen und teilweise gar zum Tod der betroffenen Kinder kam - als fatale Fehlentscheidung erwies. Angesichts solch dramatischer Fälle ist der o.a. Denk-ansatz zu hinterfragen. So vertreten andererseits viele die Meinung dass ein un-angemessenes Vertrauen in die Fähigkeiten der Eltern in der Kinder- und Jugend-hilfe völlig unangebracht sei und lieber zu früh als zu spät eingegriffen werden soll-te, sobald es ausreichend Anzeichen gibt die dies rechtfertigen, im Hinblick darauf, dass die Sicherung des Kindeswohls absolute Priorität hat. Daraus ergibt sich die Frage „Handelt es sich bei der Inobhutnahme nach §1666 BGB und § 42 SGB VIII um eine probate Hilfsmöglichkeit zum Schutz von Kindern und Jugendlichen oder um einen unangemessenen Eingriff in die familiäre Privatsphäre?“, welcher ich in dieser Hausarbeit nachgehen werde. Hierzu definiere ich zunächst den Begriff der „Inobhutnahme“ und erläutere die wichtigsten Rahmenbedingungen und Vorraus-setzungen. Anschließend gehe ich auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der Inobhutnahme sowie auf Kritik an dieser Maßnahme ein.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition und Rahmenbedingungen der „Inobhutnahme“ nach § 42 SGB VIII
3. Voraussetzungen für eine „Inobhutnahme“ nach § 42 II SGB VIII
3.1 Inobhutnahme auf Wunsch des Minderjährigen, § 42 I 1 Nr. 1 SGB VIII
3.2 Inobhutnahme bei dringender Gefahr für das Kindeswohl, § 42 I 1 Nr. 2 SGB VIII und § 1666 I BGB
3.3 Unbegleitete ausländische Minderjährige, § 42 I 1 Nr. 3 SGB VIII
4. Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit von „Inobhutnahmen“ nach § 42 I SGB VIII
5. Kritik an der Maßnahme „Inobhutnahme“ nach § 42 I SGB VIII
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis