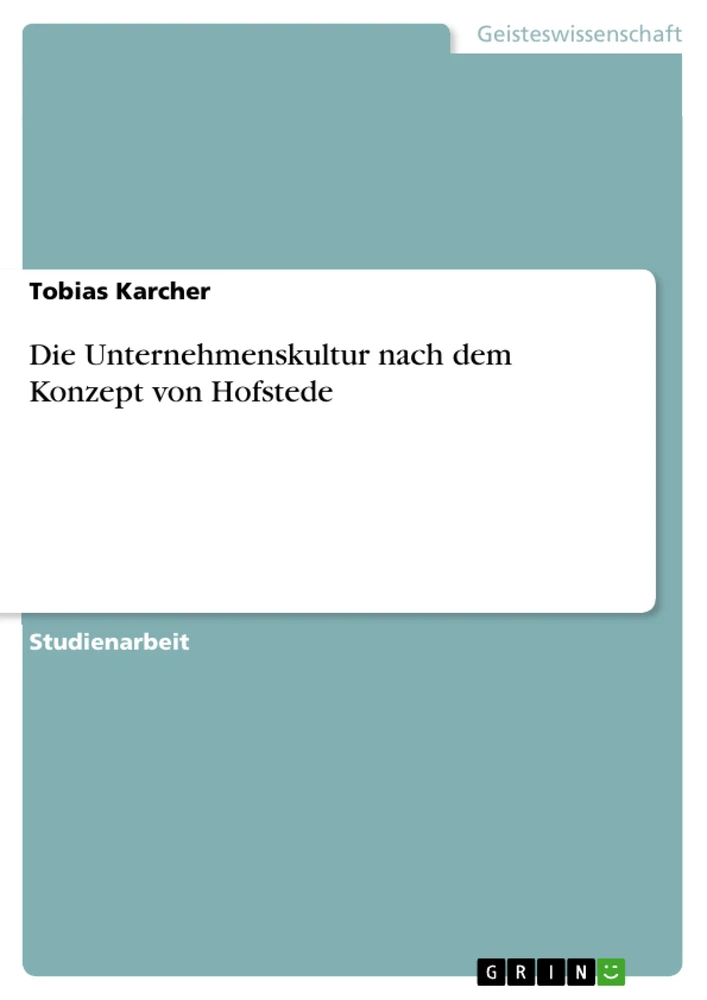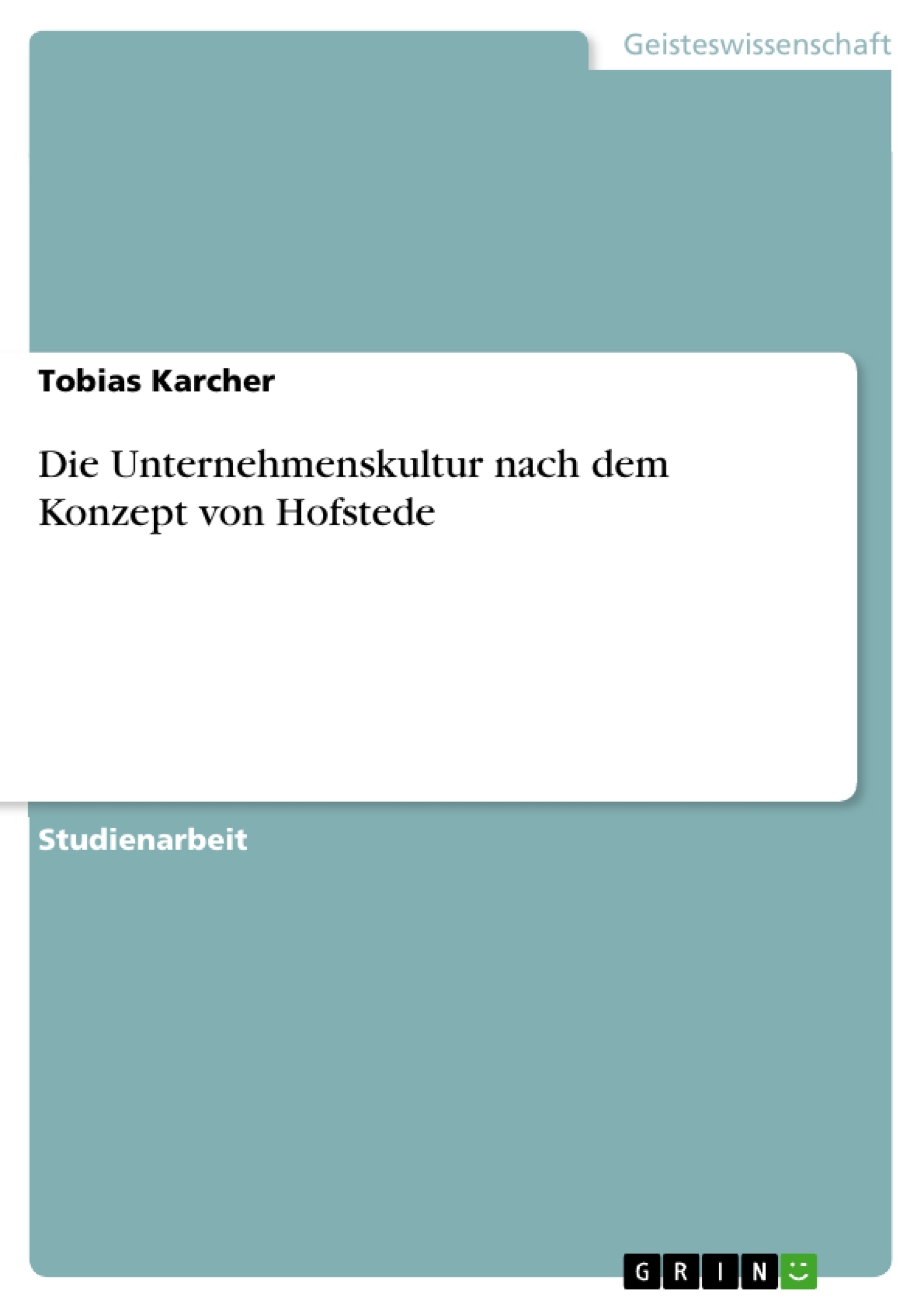„Gerade in einem immer komplexer werdenden globalen Umfeld sind gemeinsame, in der Unternehmenskultur verankerte Werte eine wichtige Orientierung und damit die Basis für geschäftlichen Erfolg.“
Aufgrund steigender Internationalität von Unternehmen und steigender internationaler Zusammenarbeit in Form von Joint Ventures, strategischen Allianzen und transnationalen Fusionen ist es notwendig, sich mit kulturellen Fragen auseinanderzusetzen. So versteht Hofstede (2006) unter einer nationalen beziehungsweise Organisationskultur die kollektive mentale Programmierung des Geistes, die die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen, beziehungsweise die Mitglieder einer Organisation, von einer anderen unterscheidet.
Im Bereich der Sozialwissenschaften gibt es mehrere Ansätze und Konzepte, die Unternehmenskultur analysieren und beschreiben. Darunter ist Hofstede zu nennen, der ein Kulturkonzept aufgestellt hat, das auf einer Befragung von IBM-Mitarbeitern aus mehr als 60 Ländern in den 70er Jahren basiert. Daraus leitete er ein nationales Kulturkonzept ab (2.1), das aus fünf Kulturdimensionen besteht, die in 2.1.1 bis 2.1.5 vorgestellt werden sollen. Darüber hinaus sollen in 2.2 anhand eines Unternehmensbeispiels und in 2.3 anhand einer Erörterung die Frage beantwortet werden, inwieweit Hofstedes Kulturkonzept für das modernde Management und die Unternehmensführung von Bedeutung ist. Kapitel 3 fasst schließlich die Erkenntnisse zusammen und setzt sich kritisch mit Hofstedes Kulturkonzept auseinander.
Da Buß (2009) in seinem Buch „Managementsoziologie“ Hofstedes fünf klassische Kulturdimensionen vorstellt, wird im Rahmen dieser Arbeit ebenfalls auf diese Dimensionen eingegangen und das sechsdimensionale Modell der Organisations-kultur aus der IRIC-Studie nur kurz behandelt.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hofstedes Konzept der kulturellen Dimensionen
2.1 Die Studien
2.1.1 Machtdistanz
2.1.2 Individualismus vs. Kollektivismus
2.1.3 Maskulinität vs. Femininität
2.1.4 Unsicherheitsvermeidung
2.1.5 Langfrist-/Kurzfristorientierung
2.2 Unternehmenskultur am Unilever-Fallbeispiel
2.3 Bedeutung für das moderne Management
3 Zusammenfassung
Anhang
Literaturverzeichnis
Internetverzeichnis