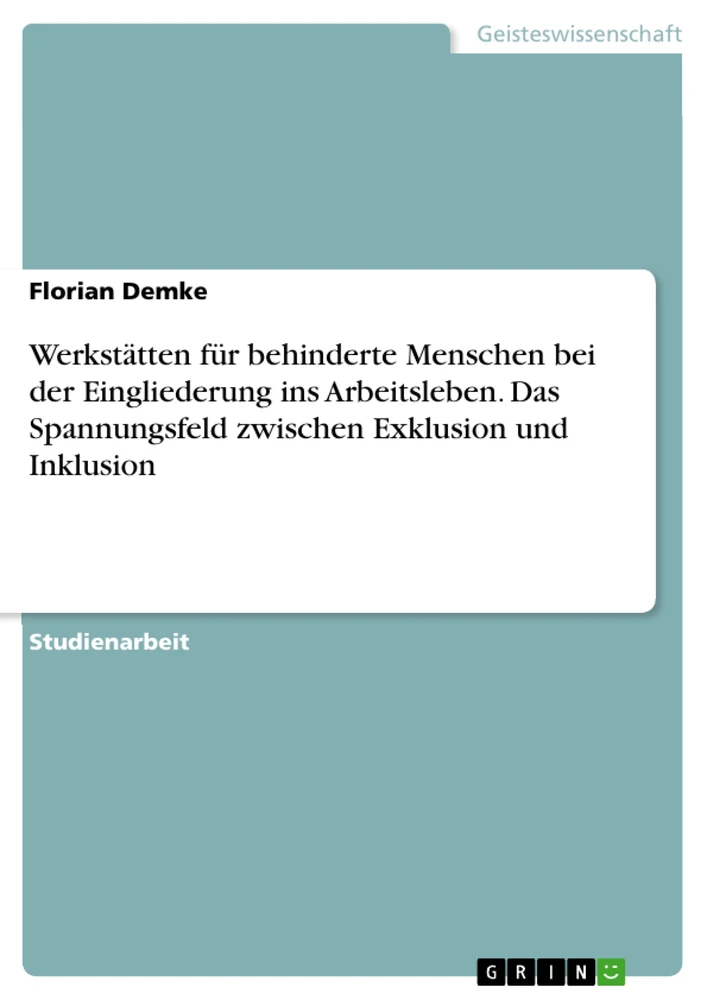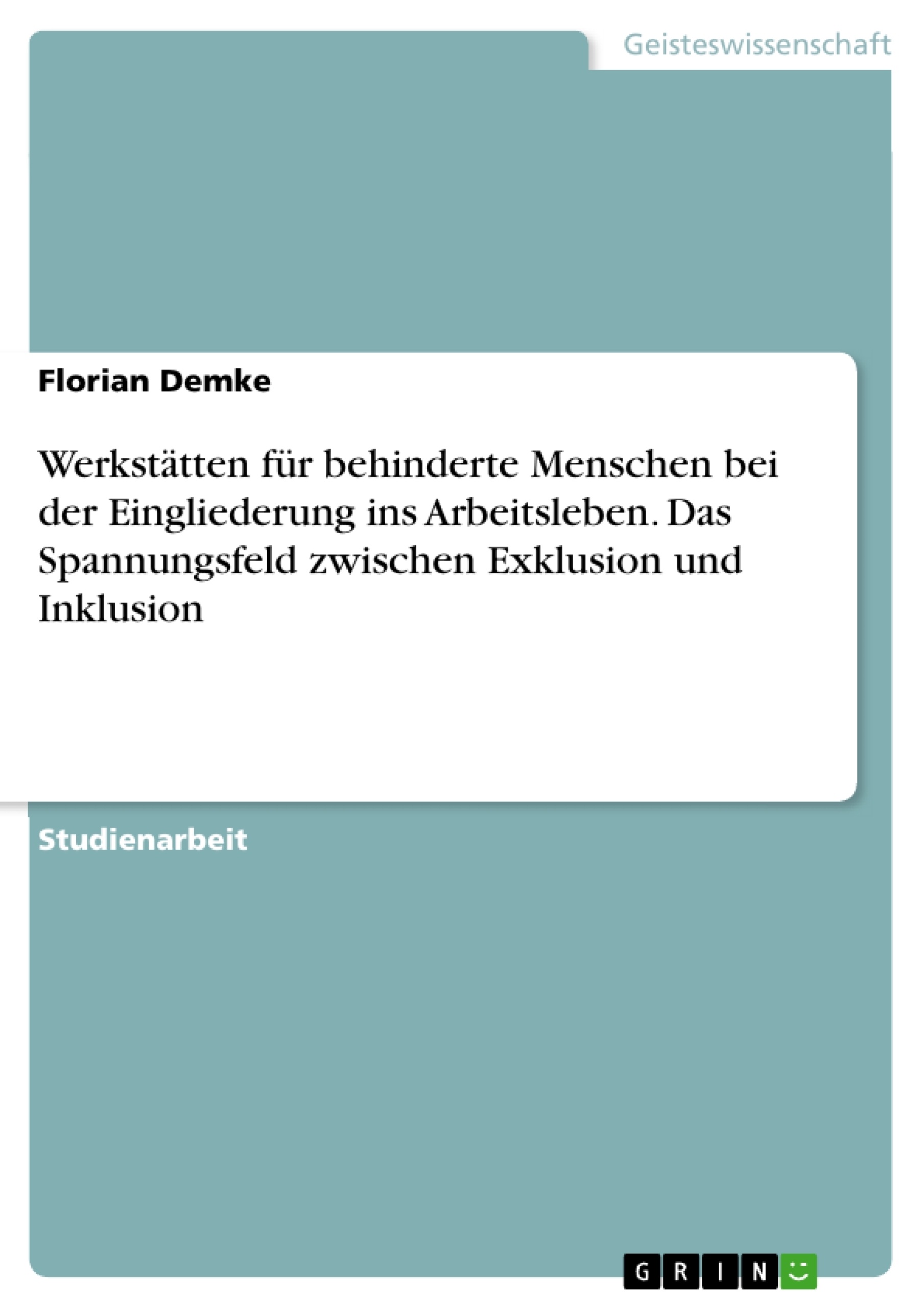Werkstätten für behinderte Menschen sind staatlich geförderte Einrichtungen, die die Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in das Arbeitsleben unterstützen
sollen. Im Jahr 2007 verzeichneten die deutschen Werkstätten über 275.000 Beschäftigte; Menschen, „[...] die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können [...]“. Während Werkstätten auf der einen Seite einen rechtlichen, sozialpolitisch gewollten Auftrag erfüllen, der die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben beinhaltet, werfen KritikerInnen den Institutionen auf der anderen Seite vor, das gleichberechtigte Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen zu unterbinden: „ ,Behindertenwerkstätten sind Aussonderungseinrichtungen. Zwar sind es oft sehr schöne Gebäude, aber sie bleiben ein goldener Käfig.’ [...] Eine wirkliche Inklusion der Behinderten in die Gesellschaft und den ersten Arbeitsmarkt finde über die Werkstätten nicht statt.“
Dem Verfasser stellt sich im Folgenden die Frage, inwiefern sich das hier beschriebene Spannungsfeld zwischen den beiden Polen Ex- und Inklusion begreifen lässt. Hierzu ist es erforderlich, verschiedene Perspektiven einzunehmen um ein möglichst genaues Gesamtbild über die verschiedenen Wirkungspotenziale der WfbM zu erlangen.
Im ersten Abschnitt dieser Arbeit wird der Verfasser kurz die dieser Arbeit zugrunde liegenden Begriffe Exklusion und Inklusion erläutern, um mögliche Verständnisschwierigkeiten in der Auslegung der nachfolgenden Ausführungen zu verhindern.
Im anschließenden Kapitel wird aus soziologischer Sicht hinterfragt, inwiefern sich der Status des Menschen mit Behinderung auf dessen Arbeitssituation auswirkt und
wo sich Faktoren für Ex- bzw. Inklusion in der derzeitigen Konzeption der Teilhabe am Arbeitsleben ausmachen lassen. Nachfolgend liefert der Text eine Auseinandersetzung mit den sozialpolitischen Rahmenbedingungen der Werkstätten für behinderte Menschen und möglichen Konsequenzen. Bevor der Verfasser abschließend ein Resümee aus den vorangegangenen Erarbeitungen zieht, betrachtet Abschnitt 5 der Arbeit die für den Bereich der Sonder- und Rehabilitationspädagogik eminente UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und hinterfragt, inwiefern die dort benannten Rechte eine Umgestaltung der bundesdeutschen Sozialpolitik und der Teilhabe am Arbeitsleben nach sich ziehen müssen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Begriffsklärung: Exklusion - Inklusion
3.Arbeit und Behinderung aus soziologischer Perspektive
4.Die sozialpolitischen Rahmenbedingungen der WfbM
5.Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und ihre Implikationen für die Gestaltung von Erwerbstätigkeit
6.Fazit: Werkstätten für behinderte Menschen im Spannungsfeld zwischen Exklusion und Inklusion
7. Literaturverzeichnis