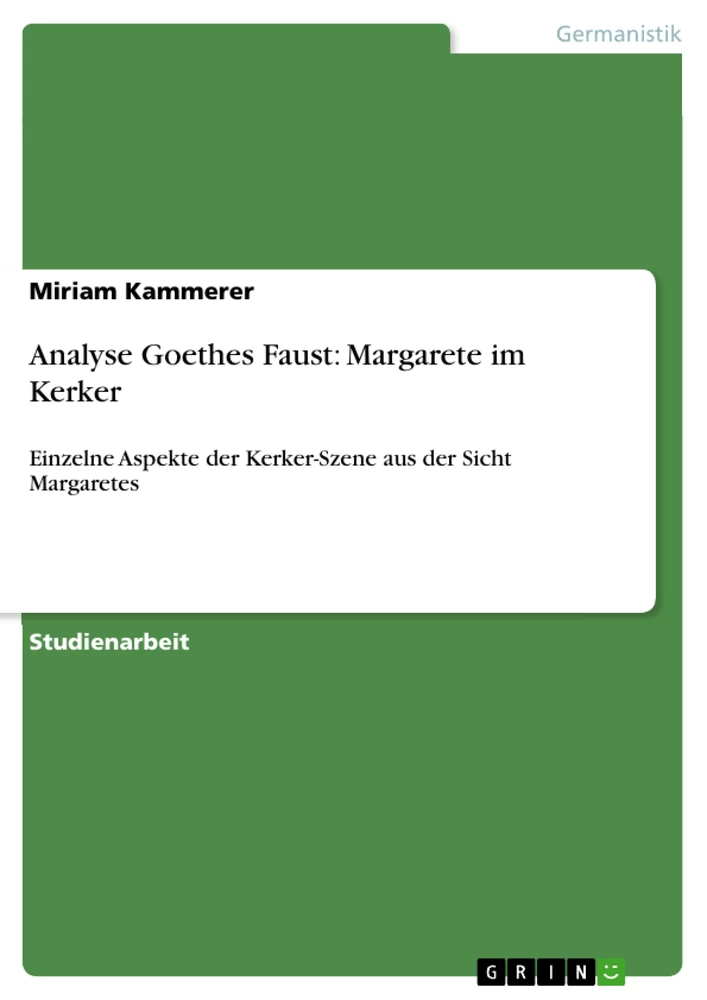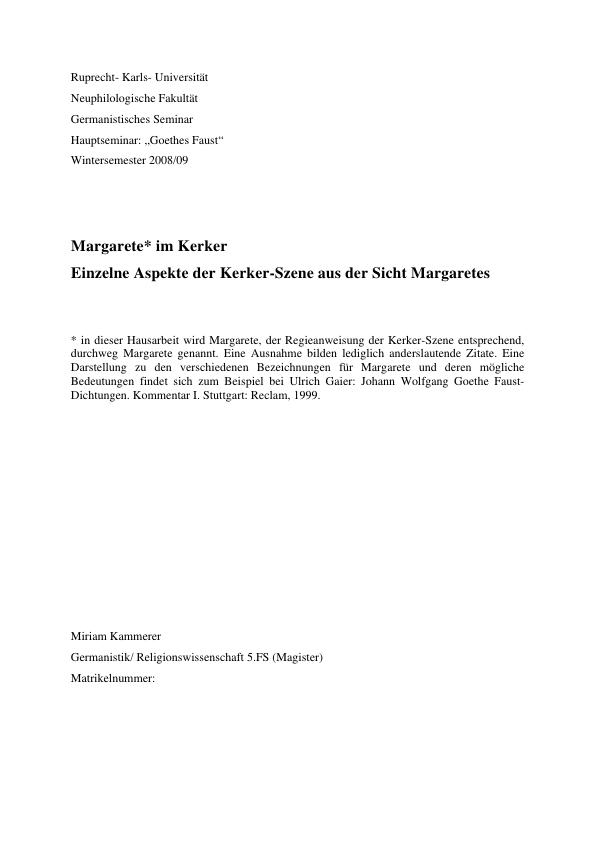Die Kerker- Szene gehört zu den ältesten Bestandteilen des „Faust I“ und kommt schon in der Abschrift des Hoffräuleins von Göchhausen (1775/76) vor. Schöne führt aus, dass die Kerker- Szene schon 1772 entstanden sein könnte . Gaier datiert die Entstehung später, etwa ab Sommer 1773. Im „Urfaust“ ist die Szene noch in Prosa, der klassische Goethe arbeitete die Szene schließlich in Verse um. In einem Brief vom 5. Mai 1798 schildert er Schiller sein Vorhaben, die Szene umzuarbeiten:
Meinen Faust habe ich um ein gutes weiter gebracht. Das alte noch vorrätige höchst konfuse Manuskript ist abgeschrieben und die Teile sind in abgesonderten Lagen, nach den Nummern eines ausführlichen Schema’s hinter einander gelegt, nun kann ich jeden Augenblick der Stimmung nutzen, um einzelne Teile weiter auszuführen und das ganze früher oder später zusammen zu stellen.
Ein sonderbarer Fall erscheint dabei: Einige tragische Szenen waren in Prosa geschrieben, sie sind durch ihre Natürlichkeit und Stärke, in Verhältnis gegen das andere, ganz unerträglich. Ich suche sie deswegen gegenwärtig in Reime zu bringen, da denn die Idee, wie durch einen Flor durchscheint, die unmittelbare Wirkung des ungeheurn Stoffes aber gedämpft wird.
Goethe bezweckte also eine Dämpfung des Stoffes mit seiner Umformung, dies trifft sicher auf die Kerker-Szene in besonderer Weise zu. In der Sekundärliteratur wird diese Umarbeitung in Lyrik zwar als meisterhaft bezeichnet, es kommt aber auch zum Ausdruck, dass die menschliche Extremsituation im „Kerker“ kaum lyrisch ausgedrückt werden könne und dadurch mehr als nur eine Dämpfung bewirkt wurde. Durch die Umarbeitung verlängerte sich die Szene um 68%, von 709 auf 1194 Wörter in der endgültigen Fassung.
Diese Abschlussszene des „Faust I“ erfüllt verschiedene Funktionen innerhalb des Dramas. Zum einen schließt sie die Gretchen-Handlung sowie den gesamten ersten Teil des „Faust“ ab, zum anderen führt sie Faust und Margarete erneut zusammen. Sie begegnen sich das erste Mal seit der Szene „Marthens Garten“. Das heißt, es kommt zu einer endgültigen Entscheidung über ihr Verhältnis. Das Ende weist gezielt über sich hinaus und leitet so schon den zweiten Teil ein. In dieser Hausarbeit wird die Kerker-Szene aus der Sicht Margaretes untersucht, dabei können nur einzelne, ausgewählte Aspekte in Betracht gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Einzelne Aspekte der Kerker-Szene mit dem Fokus auf Margarete
2.1 Das Lied vom Machandelbaum
2.2 Vokabular, Wortwahl und Sprache der Kerker – Szene – einige Beobachtungen
2.3 Margaretes Zustand im Kerker – verschiedene Ansichten
2.3.1 Die „Wahnsinndiagnose“ – literarisch begründet
2.3.2 Margarete als „Heilige“
2.3.3 Versus: Wahnsinn – attestiert durch Methoden der Psychiatrie
2.3.4 Margarete – eine Hexe?
2.3.5 Ein neurobiologischer Ansatz
2.3.6 Zusammenfassung
2.4 „Wir werden uns wieder sehn; Aber nicht beim Tanze“ (V.4586f.)
2.5 „Ist gerettet“ (V.4611)
3 Fazit
4 Literaturverzeichnis
5 Anhang