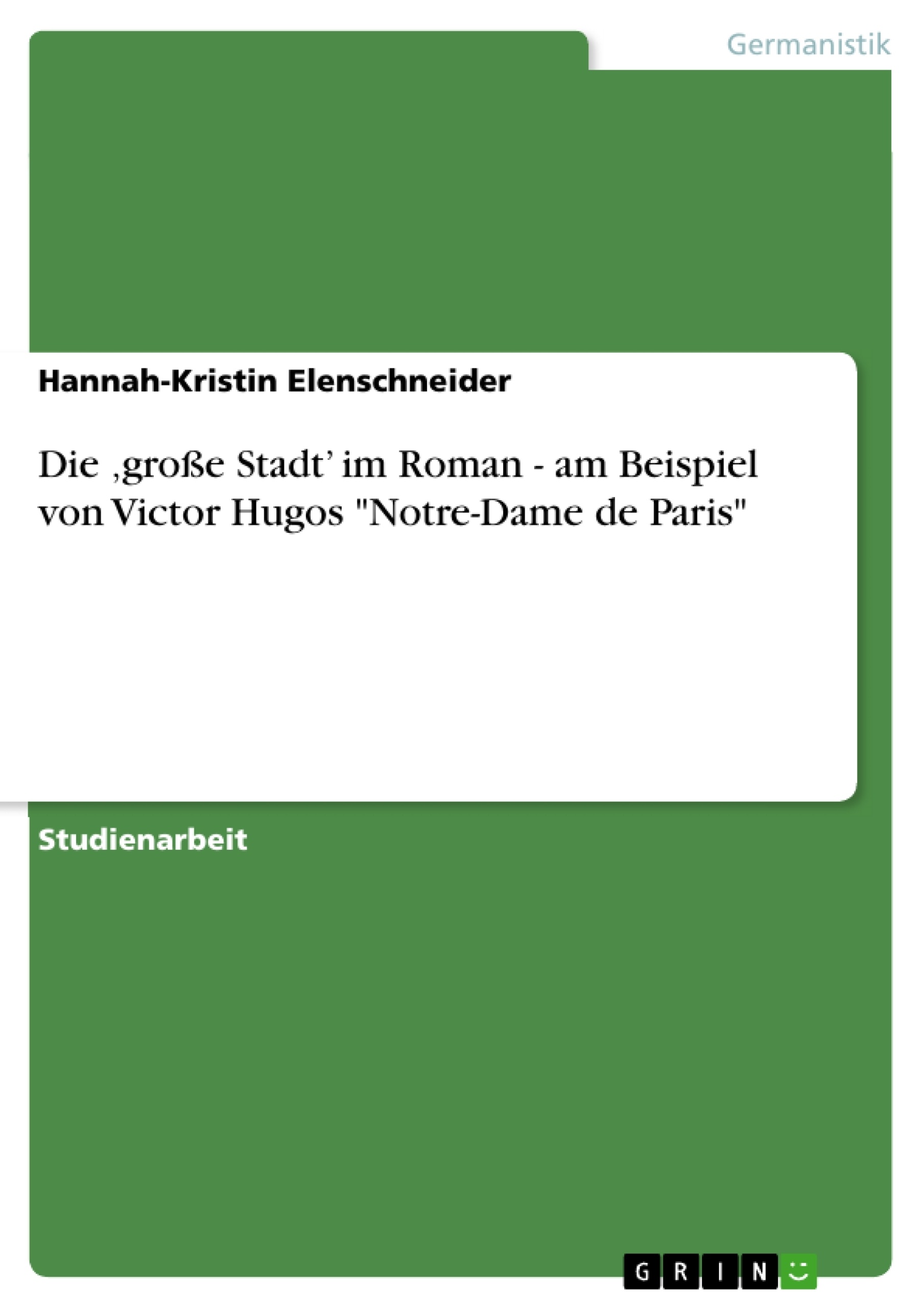Mitte des 18. Jahrhunderts nahm die Bedeutung der (Haupt-)Städte zu. Folglich wurden sie, in einem bis dahin schwer vorstellbaren Ausmaß, zum Lebensraum für eine immer größere Anzahl von Menschen. So zählte Paris 1800 547 000 Einwohner, 1850 überschritt die Stadt die Millionengrenze und hatte 1901 schließlich 2 269 000 Einwohner. Die Autoren nahmen vor allem die veränderten Lebensumstände sowie städtebauliche Veränderungen in den Großstädten wahr. Das Großstadtleben wurde nunmehr als eine neuartige Lebensform und als spezifisch moderne Erfahrung angesehen; die Großstadt selbst wurde zum Inbegriff der modernen Metropole. Damit beginnt die literarische Auseinandersetzung mit der ‚großen Stadt’. Diese ist nicht mehr nur Schauplatz, Ortsangabe oder Hintergrund einer Handlung, sondern sie wird Thema und Gegenstand der Literatur.
Der vorliegenden Hausarbeit liegt Notre-Dame de Paris von Victor Hugo (1802-1885) in der französischsprachigen Originalausgabe als Primärtext zugrunde. Dieser soll als Beispiel für die Darstellungsweise der ‚großen Stadt’ im Roman vor Berlin Alexanderplatz dienen.
Thema dieses Romans, wie es sein Titel bereits andeutet, ist die französische Hauptstadt Paris. Ausgehend von einer allgemeinen Einführung zum Mythos dieser Stadt und einer formalen wie inhaltlichen Textanalyse des Romans werden einzelne Aspekte in der Art und Weise der Großstadtbeschreibung näher beleuchtet. Wie wird die Stadt Paris dargestellt und welche Attribute werden der personifizierten Stadt zugeschrieben? Dabei wird unter anderem auf die zwei verschiedenen Darstellungsweisen der mittelalterlichen und der neuzeitlichen Stadt Paris eingegangen. Wie werden diese beiden Epochen beschrieben und wie werden sie im Roman unterschieden bzw. miteinander in Verbindung gebracht?
Inhaltsverzeichnis.
Einführung.
I. Zum Mythos der Großstadt Paris im 19. Jahrhundert
1. Grundzüge der Entstehung des Parisromans
2. Notre-Dame de Paris als Ort der Erinnerung
3. Paris als Hauptstadt des 19. Jahrhunderts
II. Strukturanalyse des Romans Notre-Dame de Paris von Victor Hugo
1. Thema und Inhalt des Romans
1.1Fiktive Hauptpersonen des Romans
1.2 Haupthandlung des Romans
2. Einzelne Kapitel über die Großstadt Paris im Roman
2.1 Livre Deuxième. Chapitre II – La place de Grève
2.2 Livre Sixième. Chapitre II – Le trou aux rats
2.3 Livre Troisième. Chapitre I – Notre-Dame
2.4 Livre Troisième. Chapitre II – Paris à vol d’oiseau
III. Paris als Gegenstand des Romans Notre-Dame de Paris von Victor Hugo
1. Entwurf der Großstadtumwelt von Paris zu verschiedenen Tageszeiten
1.1 Beschreibungsweise einzelner Plätze und Stadtviertel
1.2 Beschreibungsweise der Häuser und Straßen
2. Entwurf des Großstadtlebens der Einwohner von Paris
2.1 Gewöhnliche Lebenswelt der Pariser
2.2 Lebenswelt der Gauner und Diebe als Gegenbild
3. Zentralperspektive Notre-Dame de Paris
3.1 Livre Troisième. Chapitre I – Notre-Dame
3.2 Livre Troisième. Chapitre II – Paris à vol d’oiseau
IV. Paris im Wandel von der mittelalterlichen zur neuzeitlichen Großstadt
1. Darstellungsweise der spätmittelalterlichen Stadt Paris im Roman
1.1 Merkmale der mittelalterlichen Stadt Paris
1.2 Bedeutung des gotischen Baustils
1.3 Aufruf zur Bewahrung der historischen Stadt Paris
2. Darstellungsweise der modernen Großstadt Paris im Roman
2.1 Livre Cinquième. Chapitre II – Ceci tuera cela
2.2 Kritik an der Zerstörung mittelalterlicher Bauwerke
2.3 Hinweise auf die Neugestaltung der Stadt
3. Gegenüberstellung der beiden Wahrnehmungsweisen von Paris
Schlusswort.
Literaturverzeichnis.
1. Primärliteratur
2. Sekundärliteratur