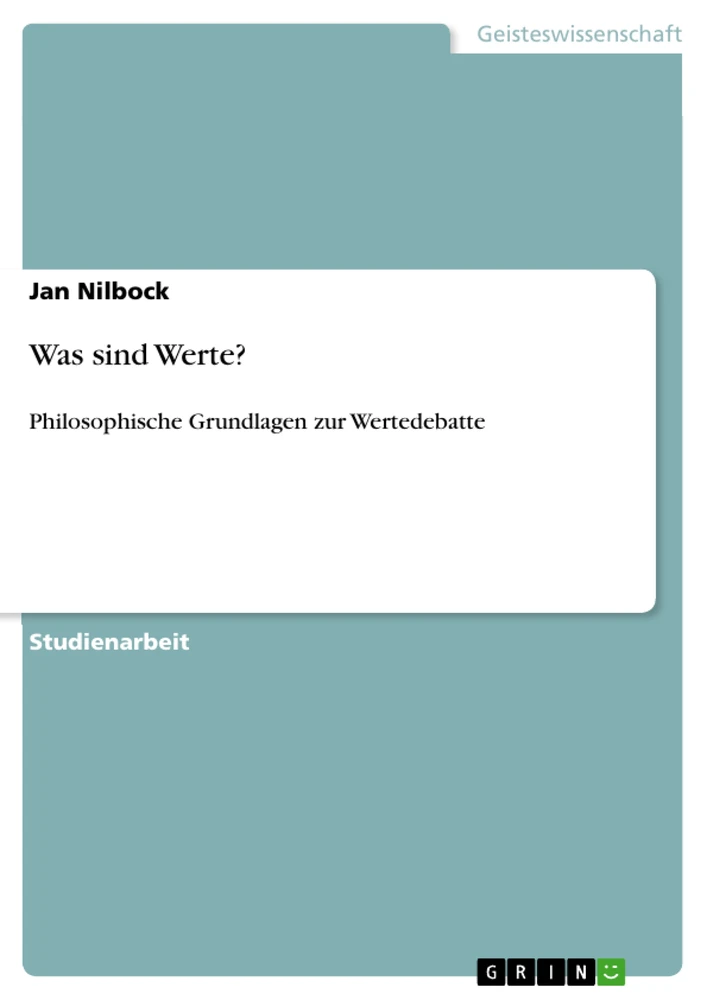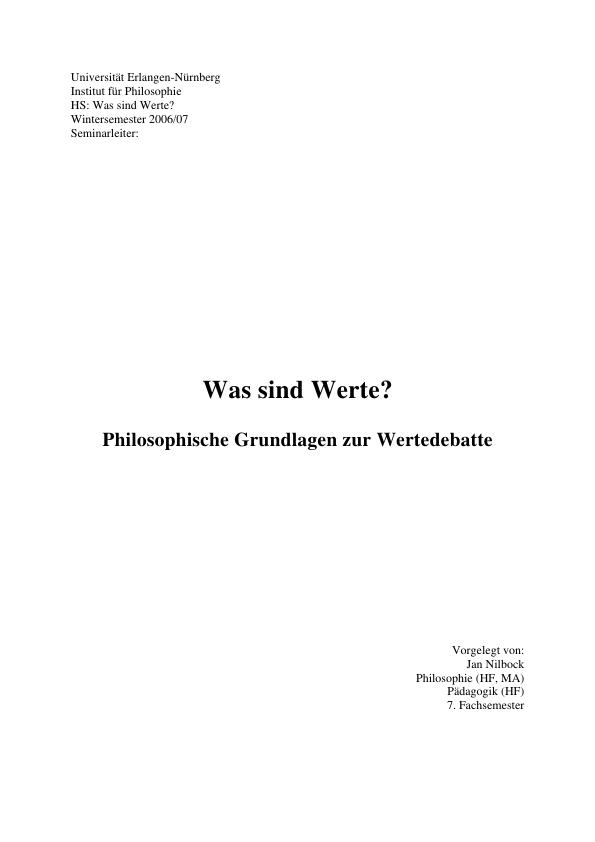Diese Arbeit untersucht die Bedeutung, Geltung und den ontologischen Status von Werten. Dabei wird insbesondere auf die verschiedenen Arten von Werten und die unterschiedlichen Konzepte bzw. Positionen innerhalb der Wertphilosophie eingegangen. Diese lassen sich einteilen in Objektivismus, Subjektivismus, Pluralismus, Monismus. Außerdem werden auch kritische Einwände behandelt.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Hauptteil
2.1 Theoretische Vorüberlegungen.
2.1.1 Der Wertbegriff
2.1.2 (Onto)logische Einordnung
2.2 Arten von Werten
2.2.1 Der ökonomische Wert
2.2.2 Der ästhetische Wert
2.2.3 Der ethische Wert
2.3 Positionen in der Wertephilosophie
2.3.1 Objektivismus
2.3.2 Subjektivismus
2.3.3 Monismus
2.3.4 Pluralismus
2.3.5 Weitere alternative Konzepte
2.3.6 Kritische Beiträge zur Wertephilosophie
3 Schluss
4 Literaturverzeichnis: