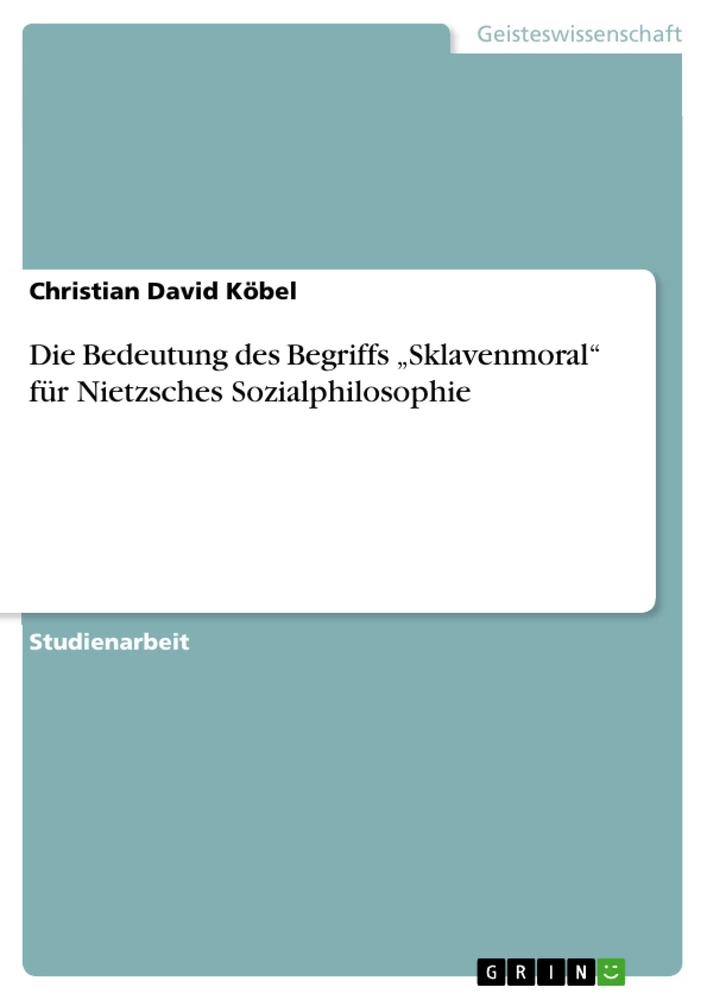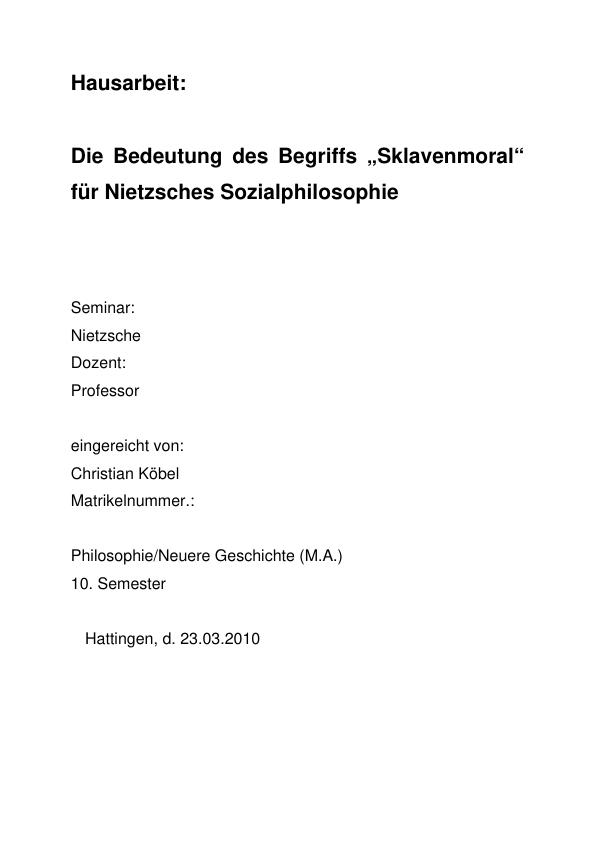Die vorliegende Arbeit wurde im Anschluss an ein Seminar zum Thema „Nietzsche“ an der Universität Duisburg-Essen im Wintersemester 2009/10 verfasst. Gelegentlich wurde dort in den Diskussionen das Wort „Sklavenmoral“ verwendet, welches einen zentralen Schlüssel zum Verständnis der Sicht Nietzsches auf die Moral darzustellen scheint. Dieser Begriff war prägend für Nietzsches späte Werke, insb. „Jenseits von Gut und Böse“ und „Zur Genealogie der Moral“, welche allerdings – aufgrund der zeitlichen Beschränkungen des Semesters – leider nicht im Lektüreplan des Seminars Platz finden konnten.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die Entstehung und Bedeutung des Begriffs „Sklavenmoral“ untersucht werden. Wie ist der Begriff in das philosophische Gesamtwerk Nietzsches einzuordnen? Befinden sich in den im Seminar behandelten Werken Nietzsches bereits Vorstufen einer „Sklavenmoral“ oder taucht der Begriff hier schon unter anderem Namen auf? Wie plausibel und schlüssig erscheinen Nietzsches Aussagen über die „Sklavenmoral“? Was könnte Anlass zu Kritik geben? Wie steht es mit der Geltungsfrage?
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Fragestellungen
1.2 Quellen und Methode der vorliegenden Untersuchung
2 Hauptteil
2.1 Nietzsches Definition von „Sklavenmoral“
2.2 Das Phänomen der „Sklavenmoral“ am Beispiel von Antike, Christentum und Sozialismus
3 Ergebnisse und Fazit
4 Bibliographie