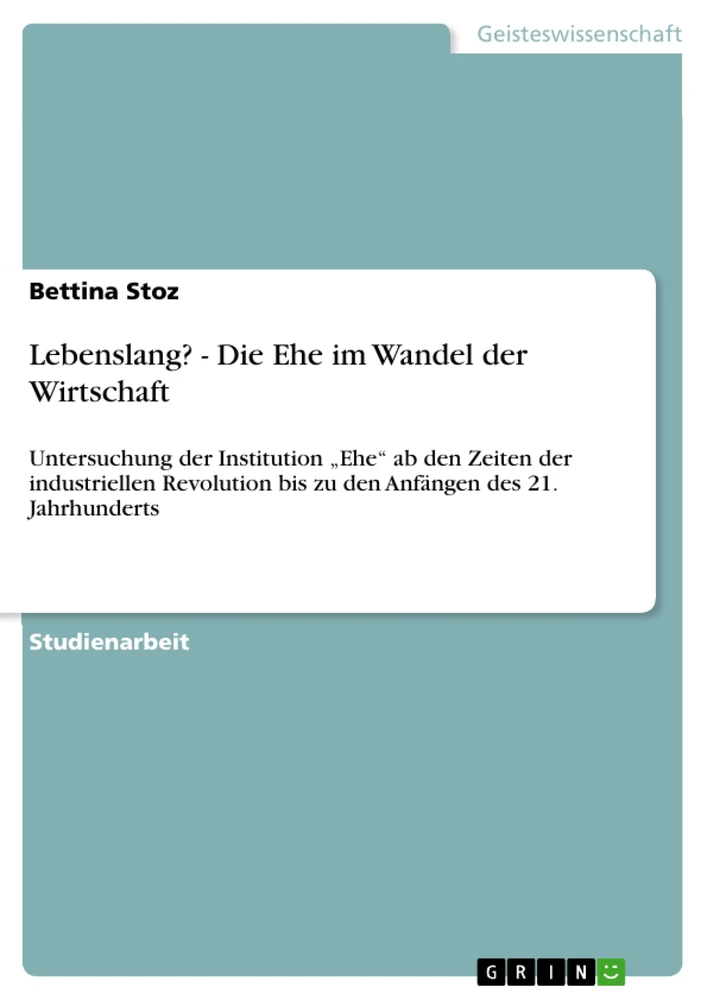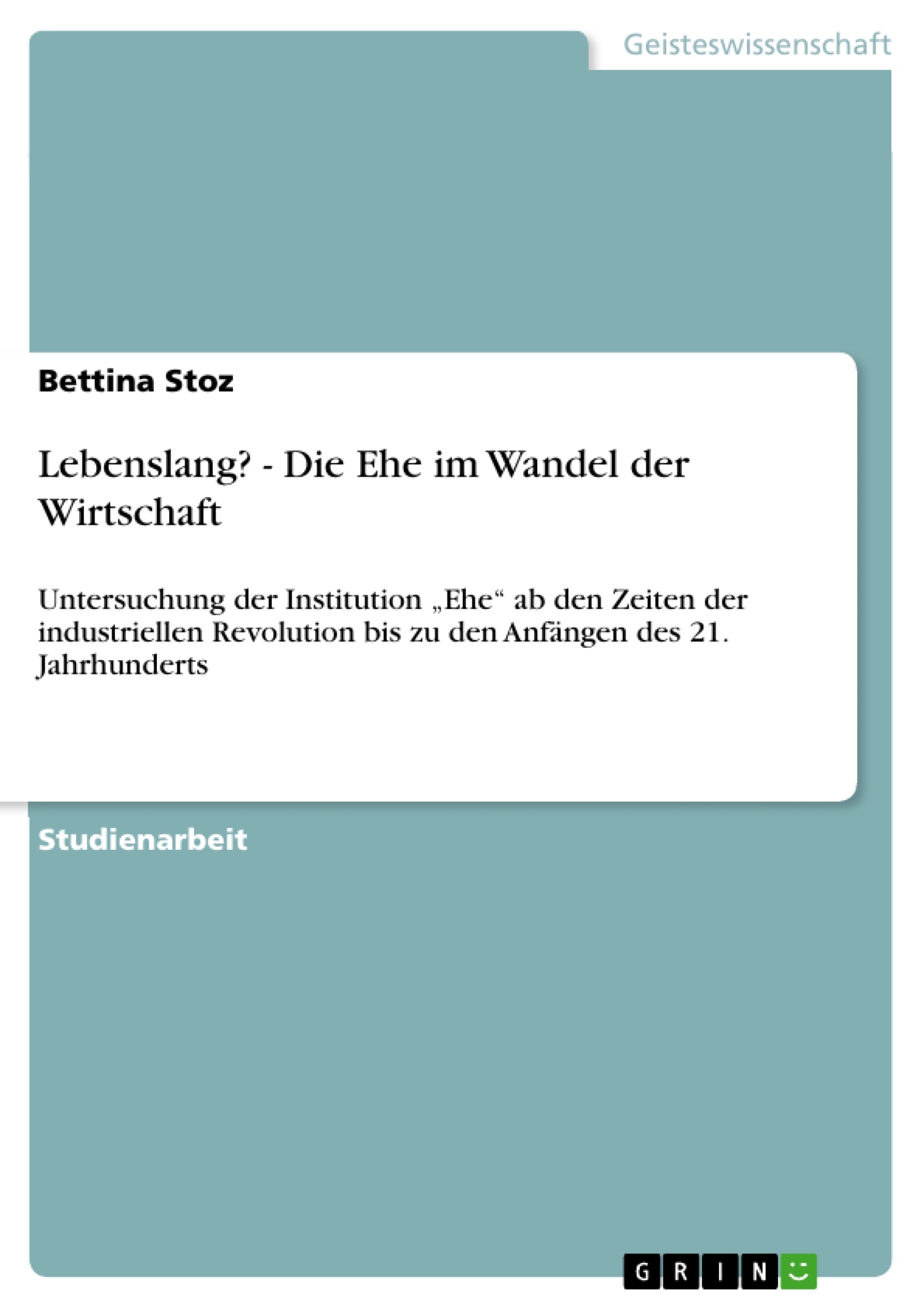Die „Ehe“ ist ein für jeden bekannter Begriff, der vermeintlich dasselbe meint. Bei näherer Betrachtung jedoch ist unter diesem Begriff über die verschiedenen Epochen und über die verschiedenen Staaten unserer Welt inhaltlich anderes in Zusammenhang zu sehen. Meine Untersuchungen sollen die deutsche Geschichte von „Ehe“ und damit zusammenhängend „Familie“ beschreiben, um nachfolgend Ansätze für den immensen Wert- und Bedeutungswandel der Institution Ehe zu finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Die Ehe – Eine Begriffsbestimmung
2. Veränderungen/ Sinneswandel ab den Zeiten der industriellen Revolution
2.1. Institutionalisierung
2.2. Wandel der sozialen Lebensformen
2.3 Entdeckung der Kindheit
3. Das Wirtschaftswunder bis zu der Zeit der dritten Industrialisierungsphase
3.1. Wachsender Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit
3.2. Wandel und Vielfalt ab dem Ende des Wirtschaftswunders
4. Ursachenforschung zu den sinkenden Ehezahlen
4.1. Die Gleichstellung der Frau
4.2. Sozialpsychologische Betrachtungen
4.3. Entwicklungspsychologische Betrachtungen
4.4. Systemtheoretische Betrachtung
5. Auswertung, Beurteilung und inspirierte Vorausschau
6. Literaturverzeichnis
7. Abbildungsverzeichnis